Digital Journal for Philology
Das Böse im System des Pop?
1 Pop oder Schlager?
Mit Pop sind wir schon ganz gut, aber mit dem Schlager kommen wir nicht zurecht. Es besteht zwar eine weitgehende Einigkeit darüber, dass er zur populären, aber nicht zur Pop-Musik im engeren Sinne gehört. Aber warum das so ist, ist schon viel weniger klar. Ebenso wenig klar ist neuerdings auch, wo die Grenze verläuft. Für mein zunächst einmal ganz unreflektiertes Empfinden sind Songs von, sagen wir, Andreas Bourani, Max Giesinger, Philipp Poisel oder Frida Gold Schlager; gespielt werden sie aber irritierenderweise auf Popsendern. Medial präsentieren sie sich damit gerade nicht in einem Paradigma mit, sagen wir, Helene Fischer, Andrea Berg oder Andreas Gabalier, sondern mit englischen und deutschen Popsongs. Das galt in gewisser Weise schon für Acts der Generation davor wie Juli, Silbermond oder Revolverheld. Ist das Schlager oder Pop, und wer entscheidet das? Das sind echte Fragen.
Jens Reisloh, der es zumindest versucht hat, definiert das ›Neue Deutsche Lied‹, worunter er von Liedermachern bis Deutschrap die gesamte deutsche Produktion fasst – eben alles außer Schlager –, als konstitutiv ›kritisch‹: »Kritisch besagt, dass die Autoren Missstände aufdecken, benennen und zum Teil radikale Kritik üben«, meint er. Schlager dagegen erfüllten »bestimmte Funktionen, unter anderem die der ›absoluten Unterhaltung‹ sowie Zerstreuung und verhelfen dazu kurzfristig ›in eine heilere Welt [zu] fliehen.‹«1 Das Argument scheint mir aus verschiedenen Gründen nicht stichhaltig. Vor allem verdrängt es den basalen kommerziellen Unterhaltungscharakter, der Pop-Musik seit Elvis kennzeichnet, zugunsten einer vermeintlich allgegenwärtigen gesellschaftskritischen Funktion. Reisloh bekommt dann auch sofort definitorische Probleme mit dem, was er »leichte Poplieder« nennt.2 Umgekehrt können sich auch Schlagertexte sehr wohl kritisch geben (»Mein Freund der Baum ist tot«). Letztlich wird hier wohl ein Sachurteil, wenn nicht gar ein ethisches Urteil vorgeschoben, um ein ästhetisches Urteil zu begründen. Wie gesagt, Reisloh versucht es zumindest – andere wie etwa Schatz und Fuchs-Gamböck behaupten einfach, bei populärer deutscher Musik habe es sich bis ca. 1970 »um banale Schlager« gehandelt, dagegen heißt es über deutschen Punk und Wave um 1980: »Mit Schlager hatte das alles nichts zu tun, natürlich nicht.«3 Das, so suggerieren die Autoren, gelte dann auch für Juli, Silbermond oder Christina Stürmer, Acts, die im Zentrum ihres Buches Jetzt und wir stehen – in irgendeiner Weise »natürlich« scheint mir ihre Abgrenzung also nicht zu sein. Denn gerade mit solchen deutschsprachigen Bands, die Mitte der 2000er-Jahre in der unmittelbaren Wir-sind-Helden-Nachfolge groß wurden, setzt besagte Unklarheit im Verhältnis von deutschem Pop und Schlager ein, die bis heute anhält.
Noch eine zweite schlagerhistorische Zäsur spielt hier hinein: Wer im Jahre 2014 im Rock ‚n‘ Pop-Museum Gronau durch die Ausstellung »100 Jahre deutscher Schlager!« ging, konnte eine merkwürdige Erfahrung machen. Der Parcours war historisch angeordnet,4 und von den Anfängen bis weit in die 1950er-Jahre hinein konnte man sich relativ vorbehaltlos über die dargebotene Musik informieren, sich gar an ihr erfreuen. Erst in der Abteilung zu den 60er- und 70er-Jahren, die unter dem Titel »Aufbruch in die Moderne« firmierte, wurde der deutsche Schlager für mich plötzlich, ich kann es nicht anders sagen – böse. War etwa Caterina Valente noch in die leichte Muse einer internationalen Tanz-, Gesangs- und Unterhaltungskultur einzuordnen, in der sie eine durchaus gute Figur machte, schlug einem aus den Darbietungen von Stars wie France Gall, Heintje, Heino oder Tony Marshall etwas Falsches, irgendwie Übles entgegen, das sie schwer erträglich machte. Und das ist in den Jahrzehnten danach bis hin zu Helene Fischer und Max Giesinger auch nicht wirklich wieder besser geworden.
Nun taugt diese idiosynkratische Erfahrung vermutlich nicht zur Verallgemeinerung. Wir befinden uns hier auf dem Gebiet des Ästhetischen, in dem bekanntlich die Urteile nicht vollständig über eine rationale, begriffliche Argumentation herleitbar sind. Allerdings bräuchten wir mit einer wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem Gegenstand Schlager versus Pop gar nicht erst anzufangen, wenn das Urteil stattdessen dem persönlichen Geschmack eines jeden anheimgegeben wäre, es also egal wäre, welchen Status wir diesen Schlagern jetzt zuschreiben. Vielmehr verhält es sich, mit Kants Worten, deutlich komplexer, nämlich so, »daß man durch das Geschmacksurteil […] das Wohlgefallen an einem Gegenstande jedermann ansinne, ohne sich doch auf einen Begriff zu gründen […]; und daß dieser Anspruch auf Allgemeingültigkeit so wesentlich zu einem [ästhetischen] Urteil gehöre […], daß, ohne dieselbe dabei zu denken, es niemand in die Gedanken kommen würde, diesen Ausdruck zu gebrauchen«.5 Und was für das Wohlgefallen gilt, gilt eben auch für das deutliche ästhetische Missfallen, das ich damals in Gronau spürte. Ich will im Folgenden also drei Dinge versuchen, nämlich zum einen einführende Überlegungen darüber anstellen, in welchem Modus man überhaupt ernsthaft und sinnvoll wissenschaftlich über einen Gegenstand wie den deutschen Schlager handeln kann, und zwar nicht bloß historisch, sondern systematisch und ästhetisch. Zum Zweiten will ich dabei den Neoschlager besonders in den Blick nehmen. Zum Dritten aber will ich bei alledem versuchen, mein eigenes ästhetisches Vorurteil, wie ich es damals in Gronau fällte, so gut es geht begrifflich zu explizieren, um die Leser:innen letztlich von seiner Validität zu überzeugen, denn, so noch einmal Kant:
Das Geschmacksurteil selber postuliert nicht jedermanns Einstimmung (denn das kann nur ein logisch allgemeines, weil es Gründe anführen kann, tun); es sinnet nur jedermann diese Einstimmung an, als einen Fall der Regel, in Ansehung dessen es Bestätigung nicht von Begriffen, sondern von anderer Beitritt erwartet.6
Kants Ästhetik formuliert an dieser Stelle bereits einen Bezug des ästhetischen Urteils auf einen Gemeinsinn (sensus communis) – und so enthält auch mein Urteil über den Schlager, wie unqualifiziert es immer sein mag, immer schon eine politische Dimension.
2 Eine Frage des Paradigmas
Die Geschichte des deutschen Schlagers hat, soviel ich weiß, noch keine gültige Formulierung gefunden, die man als Forschungskonsens voraussetzen könnte; im Gegenteil dürften die Auffassungen auch hier weit divergieren. Deshalb sei kurz skizziert, wie sich mir diese Geschichte derzeit ungefähr darstellt: Der Schlager der 1950er-Jahre kommt – man denke noch einmal an Caterina Valente, Peter Alexander, James Last oder auch an Karel Gott in Las Vegas – noch als dominante Form deutschsprachiger Unterhaltungsmusik daher, die problemlos sowohl mit dem amerikanischen Croonertum à la Doris Day oder Frank Sinatra wie auch mit dem französischen Chanson vereinbar war; auch die Operette ist im Hintergrund immer noch anwesend. Dabei handelt es sich um Formen der Populärmusik vor Pop.
Pop wird in seiner Frühzeit Mitte der 1950er-Jahre von Veranstalter:innen, professionellen Musiker:innen und Teilen des Publikums immer wieder mit dieser Form von populärer Unterhaltungsmusik verwechselt oder ihr zugerechnet. Mit der Jugendkultur der Teenager entsteht jedoch eine neuartige Differenz zwischen Pop in einem emphatischen Sinne, wie er sich mit dem Urknall Elvis um 1955 zu formieren begann, und der älteren Unterhaltungsmusiktradition. In Deutschland führte dies zu einem ersten massiven Konflikt bei der notorischen Tour von Bill Haley & The Comets. Der spätere Star Club-Betreiber Horst Fascher erinnert sich an das Desaster des 27. Oktobers 1958 in Hamburg:
Es fing schon mit dem Ort an. Die Ernst-Merck-Halle war eng bestuhlt – tanzen unmöglich. Eine miese Voraussetzung für ein Rock ’n’ Roll-Konzert. Und wie man überhaupt auf die Idee kommen konnte, das Schlagerorchester Kurt Edelhagen als Vorgruppe zu buchen, ist mir bis heute schleierhaft. Das grenzt an Fahrlässigkeit oder einfach nur Dummheit.7
Der Ausgang ist bekannt: Die Haley-Fans zerlegten das Mobiliar und lieferten sich Straßenschlachten mit der Polizei, in Hamburg ebenso wie in West-Berlin und Essen. Kurt Edelhagen aber war keineswegs vom Typ Heino, er leitete ein Swing-Orchester, machte also einfach jene handwerklich gute Unterhaltungsmusik, von der die Veranstalter Bill Haley fälschlich für eine Art Update gehalten hatten.
Fälschlich, weil der Rock ’n’ Roll für Horst Fascher und seine Freunde eben kein weiterer Modetanz wie der Boogie Woogie oder der Lindy Hop ist. Er geht in Tanz- und Unterhaltungsmusik alten Stils nicht auf, sondern entfaltet jene neue, intensive, existentielle, für die Selbstdefinition der Jugendlichen entscheidende Dimension, die Diedrich Diederichsen in seinem Hauptwerk Über Pop-Musik herausgearbeitet hat. Kurzfassung: Man erfährt anhand eines Songs im Radio, »dass es etwas gibt«, macht dieses Erlebnis mithilfe des käuflichen Tonträgers zu einem wiederholbaren, beginnt dann, nach dem Künstler und seinem Lifestyle zu fragen, bekommt über Plattencover, Zeitschriften und Fernsehauftritte dazu erste Informationen und kann schließlich im Konzert überprüfen, ob die Stilgemeinschaft, die sich um diese Musik herum gebildet hat, tatsächlich diejenige ist, zu der man gehören will. Pop-Musik eröffnet also über ihre Mehrkanaligkeit Möglichkeitsräume für das eigene Selbstbild und den eigenen Lebensentwurf. Diese existenzielle Dimension von Pop entfaltet sich in den Jahrzehnten, von denen hier die Rede ist, in Konkurrenz zu den Angeboten der Hochkultur durch Elternhaus und Bildungseinrichtungen, als die prägende kulturelle Erfahrung der Nachkriegsgenerationen.
Dieser existentielle jugendkulturelle Faktor, der sich seit Elvis in den USA mit der Tanzmusik des Rock ’n’ Roll und dann mit dem Beat in England verband, wurde in der Rezeption in Deutschland zunächst tendenziell marginalisiert, was sich insbesondere an den deutschsprachigen Varianten der entsprechenden Musik ablesen lässt: in den 1950ern etwa an Peter Kraus, Conny Froboess oder Ted Herold. In den 1960ern lief die Differenz Pop versus Schlager dann zunächst entlang der sprachlichen Differenz englisch versus deutsch, wie sie sich etwa bei den Bravo-Ottos in den Kategorien ›Beat‹ und ›Schlager‹ manifestiert. Die deutsche Kulturindustrie hielt die erfolgreiche Musik aus England und den USA dabei eben einfach für eine neue Version altbekannter Unterhaltungsformate. Pop-Musik wurde, stark vereinfacht gesagt, bis Ende der 1960er/Anfang der 1970er im Deutschen weitgehend als Schlagermusik geframet. Davon legen beispielsweise die deutschen Cover-Versionen englischsprachiger Popsongs in den 60ern und frühen 70ern beredtes Zeugnis ab: Ob als Vorbilder nun Schnulzen, Soul-Titel, Beat oder auch härtere Rock-Nummern gewählt wurden – sie geraten damals allesamt zu Schlagern. Das gilt sogar dann noch, wenn sie von den Originalkünstler:innen selbst eingespielt wurden, »Komm reich mir deine Hand« von den Beatles etwa oder »Rote Lippen soll man küssen« von Cliff Richard. Ja, man kann die These noch verschärfen und behaupten: »Deutschland hat Pop in den 1960er-Jahren nicht verstanden.«8 Selbst pop-affine Autoren wie Rolf Dieter Brinkmann oder Peter O. Chotjewitz bezeichnen englischen Pop um 1970 herum noch als Schlager, obwohl sie durchaus ein Gespür für die Differenz beweisen. Spätestens mit Udo Lindenberg, Ton, Steine, Scherben, Kraftwerk und anderen Acts der frühen Siebziger zeigt sich jedoch ganz deutlich, dass die sprachliche Differenz eben nicht die entscheidende war. Die Pop-Musik, die den Schlager in seine spezielle semiotische Nische drängte, ist seither – wie prekär auch immer – auch in deutscher Sprache möglich.
»Once you ›got‹ Pop, you could never see a sign the same way again«, wie Andy Warhol einst formulierte.9 In Deutschland dauerte es ungefähr zehn Jahre länger, bis der neue Modus von Pop in diesem Sinne ›begriffen‹ wurde. In dem Maße allerdings, wie sich dann kulturell offene Jugendliche in der BRD mit der englischsprachigen Pop-Musik identifizieren, wird auf der einen Seite eine deutschsprachige Pop-Musik möglich, rutscht aber auf der anderen der Schlager zu jenem »Bösen« im Bereich der populären Musik ab, als das er im Bereich des Pop bis heute noch intuitiv abgelehnt wird. Die Ausdifferenzierung findet vor allem auch im Publikum statt, wobei Faktoren wie Alter und soziale Schicht (class) eine Rolle spielen – das Schlagerpublikum bilden, vereinfacht gesagt, die, die übrigbleiben, wenn eine sozial, sprachlich und intellektuell bewegliche Jugend in den dominant englischsprachigen Pop abwandert und sich dort, jenseits der Tradition ihrer Eltern, neue Möglichkeitsräume ästhetisch-gesellschaftlicher Stilgemeinschaften entwerfen lässt. Seither, so wäre meine These, bilden Pop-Musik und Schlager im Deutschen ein gemeinsames Feld, in dem sie notwendig paradigmatisch aufeinander bezogen bleiben.
Es verhält sich also gerade nicht so, dass der deutsche Schlager die existenzialisierende Intensivierung von Unterhaltungsmusik zu Pop einfach nicht mitgemacht hätte, so wie die deutschen Cover-Versionen, von denen die Rede war, aber auch der Diskurs in Zeitschriften von Bravo bis Twen diese sozusagen gar nicht bemerkt haben.10 Das wäre zu einfach. Erstens gehört der Aspekt von Unterhaltungs- und Tanzmusik nach wie vor ja auch zum Pop, wenn auch nicht als sein Wesenskern. Zweitens aber, und hier wird es jetzt ernst, nimmt auch der Schlager für seine Rezipient:innen durchaus Aspekte der intensivierten existenziellen Erfahrung und Selbstdefinition an.
An unwahrscheinlichem Ort, nämlich in Jean Amérys Hand an sich legen, wird diese existenzielle Dimension des Schlagers, verbunden mit seiner Mehrkanaligkeit und sozial situiert an einer »Hausgehilfin« erörtert, deren Suizid Améry dieselbe Würde zuerkennt wie dem Freuds oder Celans.
Die vielleicht einfältige Person, die da […] aus dem Fenster sprang, werde ich nicht los. Wie begann das? Mit »Zwei Märchenaugen, wie die Sterne so schön«, schmelzend gesungen und im Kopfhörer, mit dem sie allein auf ihrem schmalen Bettrand saß, leise wiedertönend. […] Vielleicht hat sie über die Funkanstalt der herzaufweichenden Stimme geschrieben und keine Antwort erhalten. Mag sein, sie hat in irgendeinem Papierwarenladen das Photo des Künstlers gefunden, eines Mannes mit ölglatt am Kopfe klebenden schwarzen Haaren, weichen Wangen und gegenstandslos-süßem Lächeln. Sie liebt und wird nicht wiedergeliebt, es kann nicht weitergehen […] – und wagt da jemand ein ironisches Lächeln oder ein gelehrtes Wort? Dieses entziehe ich auf der Stelle einem jeden […].11
Ohne diese existenzielle Dimension wäre auch die Camp-Fähigkeit nicht erklärbar, die dem deutschen Schlager ja in hohem Maße eigen ist. Es besteht ein Bezug zur »sensiblity of failed seriousness«,12 die Susan Sontag dem naiven Camp-Objekt zuschreibt; aber scheiternde Ernsthaftigkeit setzt eben projektierte Ernsthaftigkeit voraus. Schlager können nur Camp sein, weil es ein Publikum gibt, das sie ernst nimmt und liebt; was impliziert, dass es darüber hinaus auch ein Publikum gibt, das sie verachtet. Für die frühen 1970er-Jahre lassen sich diese Gruppen, meine ich, einigermaßen gut bestimmen: Die Bildungsbürger:innen von links und rechts bestehen auf der Hochkultur und verachten Schlager und Pop gleichermaßen; ihre Kinder, die kurz zuvor noch bei Jazz und Chansons auf der Suche waren, entdecken jetzt den englischen Pop für sich, ohne sofort den Bezug zur Hochkultur damit preiszugeben. Der Schlager bleibt damit das kulturindustrielle musikalische Angebot für diejenigen, denen für die klassische Musik die Bildung und für die Pop-Musik die sprachliche, kulturelle und intellektuelle Beweglichkeit fehlen. Da es eine Volksmusik im ursprünglichen Sinne in Deutschland nicht mehr gibt, besetzt der Schlager diese Systemstelle gleich mit (»Schwarzbraun ist die Haselnuss«). Von seiner Zielgruppe wird er als natürliche, schöne, anrührende deutsche Musik empfunden, während er aus der Distanz allenfalls als Camp, Kitsch oder Incredibly Strange Music goutierbar erscheint (nach dem Motto »It’s good because it’s awful«13).
Meine Ausgangsthese lautet also, dass der Statuswechsel, den der Schlager Ende der 1960er-Jahre erfährt, weniger mit seiner syntagmatischen Gestalt als vielmehr mit seinem paradigmatischen Bezugssystem zu tun hat. Mit der zunächst nur englischsprachigen Pop-Musik bekommt er um diese Zeit auf dem Gebiet der populären Musik und der Jugendkultur eine Konkurrenz, die seine Bedeutung nachhaltig verändert. Ich rede also, wenn ich im Folgenden vom Schlager rede, ausdrücklich nicht von Unterhaltungsmusik vor Pop, sondern von einer deutschsprachigen Musik, die sozusagen in markierter Weise nicht Pop ist insofern, als die englischsprachige Pop-Musik zu ihrem Paradigma gehört, sprich: eine Alternative zu ihr wäre. Pop, worunter ich auch Rockmusik zähle, versus Schlager ist hier die entscheidende Differenz. Ich vernachlässige dabei vollständig jene Unterschiede, die womöglich auch in englischsprachiger Musik zwischen, sagen wir, Bands wie Led Zeppelin und der George Baker Selection oder Künstlern wie Bob Dylan und Barry Manilow bestehen. Der Schlager, von dem hier die Rede sein soll, ist ein Phänomen der deutschen Kultur.
3 Stilgemeinschaft ›Deutscher Schlager‹ um 1970
Wie Pop-Musik in Deutschland, so ist auch der Schlager immer schon ein Double. Aber anders als deutscher Pop, der in den ersten Jahrzehnten immer einer, mit Frank A. Schneider gesprochen, »Ästhetik der Verkrampfung« verpflichtet ist und dessen Stärke, mit Diederichsen, in seiner »Sekundarität« liegt (dazu unten mehr), verdrängt der Schlager diese seine Doppelstruktur und behauptet, natürlich und echt zu sein, im nationalen wie im emotionalen Sinn. Was die Nachfrage der Globalisierungs- und Modernisierungsverlierer bedient, die an den internationalen, englischsprachigen Pop nicht anschließen können, wirkt auf alle anderen erwartbarerweise vor allem muffig. Es fällt nicht schwer, einschlägige Beispiele zu finden: Verklärung von Heimat unter Verdrängung der deutschen Geschichte, Mitgeklatsche zu Marschmusik, dumpfer Exotismus, traditionelle Gender-Rollen inklusive verklemmter sexueller Anspielungen – das Ganze mitunter grundiert von einem prädiskursiven Gefühl von Marginalisierung, kompensiert durch trotziges Selbstbewusstsein. Und das Zielpublikum kann aufgrund seiner oben definierten Struktur den Doppelsinn nicht decodieren, der sich regelmäßig, wenngleich unfreiwillig einstellt und gerade die Gebiete betrifft, in denen Pop um 1970 seine Stärken hat: Sex, Politik und inszenierte Identitäten. Für Außenstehende wirken die Texte und oft auch die Performances von Schlagern daher nicht selten unfreiwillig komisch oder schlüpfrig.14
Ein frühes Beispiel ist die deutsche Version von Simon & Garfunkels »I Am A Rock«, die der erfolgreiche Schlagerkomponist und -produzent Joe Menke 1966 für Die Rattenfänger schrieb:
Es tut weh ohne dich nach Haus zu gehn
Wer war der Mann, der dich zärtlich küsste heut im Mondenschein
Darling, glaube mir, ich kann auch anders sein:
Hart wie ein Stein, hart wie ein Stein.
Die depressive, existenzielle Isolation, die das amerikanische Original thematisiert, wird in der deutschen Version durch einen topischen Liebeskummer ersetzt, der sogleich in eine Drohung umschlägt. Die englische Anrede »Darling« suggeriert dabei noch eine Art Rumpfinternationalität. Der sexuelle Doppelsinn aber, der im titelgebenden Refrain »Hart wie ein Stein« steckt, wird hier gerade nicht bewusst aktiviert – wie das selbstreferentiell lesbare »Es tut we-e-eh« erschließt er sich nur einer uneigentlichen, beispielsweise campigen Lesart.
Nun mag so etwas zunächst vielleicht als ästhetisch missraten, aber im Grunde doch harmlos erscheinen. Bedenkt man aber, dass in solchen Songs Möglichkeitsräume jugendlicher Selbstdefinition entworfen werden, stellt sich die Sache schon anders dar. Es mutet dann keineswegs mehr insignifikant an, dass ausgerechnet Sex, das Thema Nummer eins im Leben eines Teenagers (und im Rock ’n’ Roll sowieso), im Raum, den der deutsche Schlager eröffnet, zum Verdrängten gehört. Und auch die unklare Gewaltandrohung (»ich kann auch anders sein«) – gilt sie der Frau, dem Konkurrenten? – wirkt wie eine Rückkehr zu maskulinen Verhaltensmustern, die etwa bei Simon & Garfunkel, die hier immerhin gecovert werden, überwunden scheinen. Die innere Verhärtung, das Nicht-Weinen-Können des isolierten Felsens im Originalsong erscheint ja eher als pathologisches Defizit, und nicht, wie hier, als brutale Ermächtigung des düpierten Liebhabers.
Vollends undenkbar sind in solchen Kontexten nicht-heteronormative Lebens- und Liebesentwürfe. In der deutschen Version des Kinks-Hits »Lola« von Nina & Mike aus dem Jahr 1970 wird die irritierende Begegnung mit einem Transvestiten durch eine überaus bürgerliche heterosexuelle ›Liebe auf den ersten Blick‹-Szene in der Disco ersetzt, wobei der Vers »und wenn wir dann alle eines Tags verheiratet sind« die selbstverständliche Perspektive ausdrücklich formuliert.
Doch selbst im Heterosexuellen scheint der Raum, den der Schlager eröffnet, vor allem bei vielen weiblichen Interpretinnen statt der eines Empowerments eher der einer potentiellen Missbrauchsstruktur zu sein. Was gemeint ist, mag eine Zusammenschau von drei um 1970 herum entstandenen Aufnahmen verdeutlichen. Sieht man sich France Galls Auftritt mit ihrem Hit »Ein bißchen Goethe, ein bißchen Bonaparte« beim Deutschen Schlager-Wettbewerb 1969 an, so sieht man (heute) eine unentspannte Performerin mit irgendwie gequält-künstlichem Lächeln und fremdgesteuerten Gesten; ihre rechte Gesichtshälfte wirkt wie ein überschminkter blauer Fleck durch häusliche Gewalt.15 Im Duett »Schön ist es auf der Welt zu sein«, das Roy Black 1971 mit der zehnjährigen Anita singt, kommt es zu einer seltsamen Verdichtung von Bildern: Der Mann schwärmt von einem dunklen Wald, das kleine blonde Mädchen von einem Eis am Stiel und »säß mal gern auf einem Krokodil«, dazu macht er Gesten des Verlängerns16 und sie freut sich über einen »Frosch im Moos« – alles Dinge, die (heute) Konnotationen von Kindesmissbrauch aufrufen, die man gern vermieden sähe. In einem Auftritt mit Dunja Rajter bedrängt Rudi Carrell (»Keine Angst, Schatz, ‘s ist nur ein Lied«) als Hotelgast in durchaus körperlicher Weise das jugoslawische Zimmermädchen, das sich im Aside fragt, ob sie schreien soll, sich dann aber an die Order des Hoteldirektors erinnert, nett zu den Gästen zu sein, und sich entsprechend willig zeigt.17 Man denke an Amérys »Hausgehilfin«.
Ich möchte wohlgemerkt hier nirgends tatsächlichen Missbrauch unterstellen. Doch scheint es mir bemerkenswert, dass, was auf uns wie die kaum verborgene Repräsentation einer Missbrauchsstruktur wirkt, für das deutsche Fernsehpublikum um 1970 heitere Unterhaltung war, die als völlig harmlos galt und vermutlich als ›niedlich‹, ›flott‹ oder ›frech‹ bewertet wurde. Die Rollen, die dabei jungen Frauen zugestanden werden, und komplementär dazu auch den übergriffigen Männern, werden jedoch auch im Unterhaltungsformat der Schlagershow als (wie auch immer fiktionaler) Möglichkeitsraum entworfen, als Angebote an das Publikum, seine libidinösen Phantasien zu formen und zu sortieren. Es geht, mit anderen Worten, auch hier immer um die Aushandlung von Denk- und Sagbarkeiten. Wie unglaublich verquer das im deutschen Schlager ausfällt, wird unmittelbar evident, wenn man sich im Gegenzug Aufnahmen von amerikanischen Pop-Stars wie Tina Turner, Janis Joplin oder Joni Mitchell aus demselben Zeitraum ansieht – ihre personae entwerfen selbständige, souverän über den eigenen Körper verfügende und sexuell aktive Frauenrollen.18
Und was für das Sexuelle gilt, gilt mutatis mutandis auch für politische Zweideutigkeit (›Schwarrrzbrrraun ist die Haselnuss‹) oder eben das hyper-artifizielle Erscheinungsbild einer erfolgreichen deutschen Schlager-Persona wie Heino, aber auch, sagen wir, Roberto Blanco oder Tony Marshall mit seinem Monchichi-Look, die alle von außen incredibly strange wirken, sich von innen aber für ihr Publikum offenbar anfühlten wie Heimat. Und es kommt ja auch keineswegs alles einfach nur dumpf daher; der Rudi Carrell-Clip oder eine Nummer wie Tony Marshalls »Schöne Maid« haben ja durchaus Humor, nur ist das eben der Humor der oben benannten Restgruppe. Freilich ist nicht zu übersehen, dass er sich zu dieser Zeit mit dem Mainstream bundesdeutscher Fernsehunterhaltung bestens verträgt. Aber wie gesagt, Unterhaltung im Sinne bloßen Entertainments ist immer nur die eine Komponente. Selbst bei vermeintlich reinen Mitklatschnummern stellt sich ja die Frage, mit wem man hier bei was mitklatscht. Was für junge Menschen sollen sich etwa in der Stilgemeinschaft wiederfinden, die Tony Marshalls Auftritt mit »Schöne Maid« in der Rudi-Carrell-Show 1971 entwirft? Welche Gender-Zuschreibung steckt hinter dem Archaismus ›Maid‹? Im Clip sind die solcherart Angesungenen erneut Servicekräfte in einem Gastronomiebetrieb; sie bewegen sich etwas gezwungen und mit irgendwie eingezogenen Schultern zur Mitklatschmusik Marshalls. Eine balanciert eine Wurst auf ihrem Teller, die dann in einer munteren Polonäse aus Köchen und Serviererinnen einem lethargischen mittelalten Publikum in einem deutsch-rustikalen Gastraum serviert wird. Incredibly strange – man muss es sehen, um es zu glauben!19 Am Publikum, wie es in solchen Inszenierungen entworfen wird und wie es in den Hitparaden brav die Marschmusik mitklatscht (Tony Marsch-schall), spürt man, so Mark Terkessidis, »geradezu körperlich«, dass der Schlager »eine Dichotomie von Fortschritt/westlich und Stillstand/deutsch am Leben« hält.20
Das verbreitete Fernweh-Thema und die zahlreichen Interpret:innen ohne deutschen Pass und mit fremdländischem Akzent lassen aber auch diesen Aspekt auf der Oberfläche erst einmal unsichtbar werden. Man kann sich als Schlager-Hörer:in also durchaus als humorvoll und weltoffen fühlen, und selbst Sexualität ist gelegentlich kenntlich repräsentiert. Verdrängung kann hier also nicht alles erklären – vielmehr ist es die Art und Weise der Darstellung und damit insbesondere auch die der angesonnenen Gemeinschaft, der man beitreten soll, die den Unterschied zum Pop ausmacht. Im Gegensatz zur älteren Kritik in der Tradition der Frankfurter Schule, die am Schlager vor allem seinen affirmativen Charakter inkriminierte, wäre also darauf zu bestehen, dass es doch sehr darauf ankommt, was affirmiert wird.
Bei allem Urlaubs-Exotismus und »Fiesta Mexicana« im Schlager sind es dann eben doch meist die deutsche Heimat und die treue Liebe, auf die es letztlich hinausläuft. Aus den »Honky Tonk Women« der Rolling Stones wird 1969 im Cover von Jack White »Schön, ja so schön sind die Mädchen zu Haus« – und zwar trotz seines cool amerikanisierten Namens. Jack White hieß mit bürgerlichem Namen Horst Nußbaum und hatte bereits eine Karriere als Fußballprofi hinter sich, als er zum Schlager kam. Er schrieb auch »Schöne Maid« und ein Jahr später einen weiteren Hit für Tony Marshall namens »Und in der Heimat«, der 1973 auch von der Deutschen Fußballnationalmannschaft für ihr Album Fußball ist unser Leben aufgenommen wurde. Darin heißt es:
Ich habe die höchsten Berge gesehen
Die Ozeane und den Wüstensand
Und so manches schöne Mädchen reichte mir
Zum Abschied unter Tränen seine Hand.
Und in der Heimat, ja, da ist es doch am Schönsten
Wo meine Wiege stand, wo ich gespielt als Kind
Und in der Heimat, ja, da ist es doch am Schönsten
Hier wo auch Vater und Mutter zu Hause sind.
Wo Pop Lebensentwürfe in Abgrenzung zur Eltern- und Kriegsgeneration entwirft, praktiziert der Schlager den Schulterschluss der Generationen. Mit den Ozeanen und der Vokabel »Wüstensand« rekurriert die zitierte Strophe direkt auf die Schlager von Freddy Quinn aus den 1950er- und frühen 60er-Jahren, deren exotische Abenteuer nautische, aber immer auch soldatische Kontexte assoziieren ließen. Das Ausland ist dabei zugleich die Sphäre der Promiskuität, während die Heimat, die der Chorus beschwört, die der Familie und damit ein Garant der Stabilität ist. Wenn die These stimmt, dass die internationale Pop-Musik hier stets implizit Teil des paradigmatischen Hintergrundes ist, dann sagen solche Songs immer auch: Wir lehnen die Lebensentwürfe des Pop mit ihrer Internationalität, Aufmüpfigkeit (»Ich will nicht werden was mein Alter ist«) und ihren potentiell freieren Formen von Sexualität und Gemeinschaft ab und bestätigen – durchaus in Kenntnis der weiten Welt – ein geschlossenes, identitäres Modell von Heimat. Freddy Quinns notorischer Song »Wir« von 1966, in dem er sich für die Hippie-Generation schämt, macht nur explizit, was in dieser Musik immer mittransportiert wird (»Wer will nicht mit Gammlern verwechselt werden? WIR«).
Dabei fällt zweierlei auf: Zum einen wird die vielbeschworene Heimat regelmäßig mit Bildern illustriert, die eher Urlaubsdias als Bildern des bundesdeutschen Familienalltags ähneln – vorzugsweise mit Motiven aus den Alpen oder von der See. Zum anderen sind Ozeane und Wüstensand um 1970 ja noch keine typischen Urlaubsziele, sondern den Deutschen, wenn überhaupt, eher aus Weltkriegszusammenhängen bekannt. Bei Freddy Quinn ist dieser Bezug mit Songs wie »Hundert Mann und ein Befehl« oder »Der Legionär« wie gesagt noch ganz offensichtlich, und auch Heino knüpft mit Liedern wie »In einem Polenstädtchen« oder »Jenseits des Tales« (1966), dem Schlesier- und Ostpreußenlied oder der vollständigen Fassung des Deutschlandliedes, die er 1977 für Hans Filbinger aufnimmt, hier an. Das erstgenannte Lied verbindet das elegant mit der oben benannten Missbrauchsstruktur: »In einem Polenstädtchen / Da wohnte einst ein Mädchen / Sie war so schön« – und dann passieren Heideröschen-artige Dinge. Welche Aspekte der deutschen Heimat und der Generation der Eltern dabei aktiv verdrängt werden, liegt auf der Hand. Undenkbar, dass beispielsweise der Name Adolf Hitler in einem deutschen Schlager dieser Zeit fallen könnte, wie in Udo Lindenbergs Song »Rudi Ratlos« (1974), wo ganz explizit die Verbindung zur Schlager- beziehungsweise Tanzmusik der Nazi-Zeit gezogen wird, oder dann wieder in der Neuen Deutschen Welle (DAF: »Der Mussolini«, 1981) oder im Deutschpunk (Rocko Schamoni).
Besonders in visuellen Formaten wird sehr deutlich, welche Art von ästhetischer Gemeinschaft den Hörer:innen angesonnen wird. So zeigt etwa ein Clip zu Heinos »Blau blüht der Enzian« von 1972 eine Wandergruppe, die von fern an jugendbewegte Wandervögel erinnert, etwa durch die umgehängten Gitarren.21 Näher besehen allerdings handelt es sich hier um eine uniage (wenn diese Parallelbildung zu ›unisex‹ erlaubt ist) Gruppe in Pseudo-Trachten, bei der Alt und Jung weniger vereint als vielmehr ununterscheidbar wirken, die sich hier in den penetranten Mitklatsch-Marschrhythmus einreiht (»Mit ihren ró-ró-ró-roten Lippen fing es an«). Sogar eine Jeans und eher städtische Outfits sind dabei – das läuft nicht auf ein jugendbewegtes Zeltlager hinaus, sondern auf einen Besuch im Ausflugslokal. Eine enzianpflückendes »Madl« im Dirndl sitzt textgerecht in der Wiese; angestrebt ist offenkundig eine alpine Landschaft, tatsächlich könnten die Aufnahmen aber auch aus einem deutschen Mittelgebirge stammen. In der ZDF-Sendung Sing mit Heino aus demselben Jahr findet sich in der Schlussnummer »Caramba, caracho, ein Whisky« eine ähnliche Crowd von undefinierter Jugendlichkeit in einer maritimen Kneipe.22 Der Song spielt in Argentinien und will einen Hauch von seemännischer Verworfenheit ausstrahlen, was durch das brave Setting – am Anfang wird ein Schiff namens Münsterland eingeblendet – jedoch immer schon domestiziert erscheint. Das Publikum dreht sich in zahmem Paartanz, und die Accessoires der Kneipe (Netze, Hängelampen, Rettungsring) eignen sich auch als Einrichtungsvorschläge für den Neubau-Partykeller. – In beiden Fällen verbindet sich eine vage Anmutung von Volkstümlichkeit mit einer extremen Künstlichkeit. Es ist kein Zufall, dass sich dazu die Klischeebilder der Alpen einerseits und der Nordseeküste andererseits eher eignen als, sagen wir, das Ruhrgebiet, Nordhessen oder Berlin. Die bewährten Zeichen amalgamieren zum Angebot einer sich durchaus als aktuell verstehenden ›Deutschness‹ für Deutsche.
Es ist leicht, vielleicht allzu leicht, sich aus unserer ästhetisch-sozialen Warte über diese Repräsentationen aus der Zeit um 1970 lustig zu machen. Aber es wird auch deutlich, dass hier ein nicht geringer Teil der Bevölkerung angesprochen und getroffen ist, der von den Modernisierungsbewegungen, für die unter anderem auch der internationale Pop steht, eben nicht repräsentiert wird. Was die Sache nicht erträglicher macht: Das Wort »Caracho« etwa, das sich im Song unter die anderen exotischen Flüche reiht, ist in der deutschen Geschichte auch durch den sogenannten Caracho-Weg in Buchenwald besetzt, über den die Neuankömmlinge im Lager, und das waren anfangs vor allem bürgerliche Intellektuelle und Linke, von der SS in einer Art munterem Spießrutenlauf getrieben wurden. Die (Volks-)Gemeinschaftsbildung lief eben immer schon auch über aggressive Ausschlüsse. Wo der Schlager sich seiner eigenen Bedingtheit, seiner Position im Gesamtfeld bewusst wird, wird es denn auch sehr schnell unangenehm, wie in dem anti-intellektuellen Text des Mitklatschsongs »Wir lassen uns das Singen nicht verbieten«, verfasst von Jack White. Es handelt sich um den erfolgreichsten Hit von Tina York, bürgerlich Monika Schwab, Schwester von Rosemarie Schwab alias Mary Roos. Die Titelzeile erinnert an den bekannten Drittes-Reich-Schlager »Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern« (»Wir lassen uns das Leben nicht verbittern«), den Heinz Rühmann 1939 sang und den später auch Freddy Quinn im Repertoire hatte. Bei Tina York konstituiert sich die eigene Stilgemeinschaft nun explizit über die Abgrenzung von den intellektuellen Schlagerverächtern:
Sie halten sich für die Klügsten der Welt
Oh, wie sind sie klug […]
Was überall auf dieser Welt
Den Menschen Freude macht
Darüber rümpfen sie doch nur die Nase
Auf das Getue sagen wir
Freunde, nun ist mal genug
Wir lassen uns das Singen nicht verbieten
Das Singen nicht und auch die Fröhlichkeit
Wer eigentlich wem und warum das Singen je verbieten wollte, bleibt im Dunkeln. Die engen Verbindungen zur deutschen Fernseh-Unterhaltung indizieren ja, dass es sich hier keineswegs um eine marginale oder marginalisierte Kulturfacette handelt. Die bildungsbürgerliche Kulturkritik von links und rechts richtet sich zu dieser Zeit ja noch unterschiedslos gegen Pop und Schlager gleichermaßen. Und doch fühlt man sich in Schlagerkreisen irgendwie nicht gut behandelt und verfällt trotzig in eine Haltung des ›Das wird man ja wohl noch singen bzw. sagen dürfen‹, die einem heute wieder nur allzu bekannt vorkommen mag. »Ein Schlager heißt doch nur ein bißchen Freud« – einmal mehr scheint zunächst alles ganz harmlos. Beachtet man jedoch die angemutete Gemeinschaft in Versen wie:
Ein Lied nach dem anderen fällt uns dann ein
Weil wir uns verstehen
Wir tanzen auf den Tischen noch beim Tralalalala
Und machen auf das eine Polonäse
Die Leute die dagegen sind
Sollen doch nach Hause gehen23
kann einem das Gruseln kommen. Denn ausgeschlossen werden hier die volksfremden Intellektuellen und Freunde des internationalen Pop im Namen einer natürlichen, volkstümlichen Feiergemeinschaft. Die Polonäse als Caracho-Weg.
4 Gegenfiguration: Das Verkrampftschöne im deutschen Pop
Das negative ästhetische Urteil scheint hier unausweichlich, allerdings sollen die Komplikationen nicht unterschlagen werden. Da ist zum Ersten der Klassen-Aspekt – wer sich von der fortschrittlich-weltgewandten Pop-Seite her kritisch gegenüber dem deutschen Schlager äußert, ist sozusagen in mehrfacher Hinsicht bereits Partei und irgendwie auch privilegiert. Genau dagegen wendet sich Yorks Schlager in seiner Anti-Intellektualität ja ausdrücklich. Da ist zum Zweiten die frühe, insbesondere in schwulen Kreisen genutzte Möglichkeit, sich diese Art von Schlager im Modus des Camp anzueignen – »it’s good because it’s awful«. Und drittens mag in der Opposition Pop versus Schlager vielleicht auf den ersten Blick eine internationale Lockerheit und Entspanntheit gegen eine deutsch-provinzielle Verkrampfung stehen, aber sobald man sich dem deutschsprachigen Pop zuwendet, sieht die Sache gleich ganz anders aus.
Deutschsprachige Pop-Musik kämpft, ob sie es weiß oder nicht, stets an drei verschiedenen Fronten, die ihren Status prekär halten: Zum Ersten muss sie ihr Verhältnis zum englischsprachigen Original-Pop definieren, zum Zweiten das zur konkurrierenden deutschsprachigen Populärmusik des Schlagers, und zum Dritten teilt sie mit aller Pop-Musik das heikle Verhältnis zur eigenen Warenform (Stichwort ›Kommerz‹). Auf allen drei Schauplätzen droht ständig Peinlichkeit, die sich, daran hat sich von Peter Kraus über Heinz-Rudolf Kunze bis, sagen wir, Andreas Bourani nichts geändert, auch zuverlässig immer wieder einstellt. Ein intelligenter Umgang mit den Herausforderungen, die in diesen Nachbarschaften liegen, kann aber auch zu enormem semiotischem Reichtum führen. »Das Beste an bundesdeutscher Popmusik war ihre Sekundarität: ihr Bezugnehmen, Imitieren, Fixiertsein auf angloamerikanische Vorbilder«, schrieb Diedrich Diederichsen bereits 1990.24
Frank Apunkt Schneider feiert 2015 die daraus resultierende »Ästhetik der Verkrampfung«, das »Verkrampftschöne«, ja »die Anmut und Würde der Verkrampfung«.25 »Der meiste bis in die 1990er hinein in den diversen Deutschlands produzierte Pop«, schreibt er:
gehört in der einen oder anderen Weise in den Einzugsbereich der Incredibly Strange Music, weil er in der Regel heillos verkrampft und frei von jener Lockerheit ist, die gelungene Popmusik auszeichnet und nach der er sich in genau dem Maße sehnt, wie sie ihm nie zur Verfügung stehen wird. Das kann den deutschen Incredibly-Strange-Pop-als-ob so grässlich machen wie Grönemeyer, aber manchmal ist er auch von einer eigenartigen und eigentlich unmöglichen Souveränität getragen.26
Das hier beschriebene Phänomen bestätigt sich regelmäßig, wenn Pop-Muttersprachler:innen auf deutsche Pop-Erzeugnisse gestoßen werden. Man sieht es etwa in Harry Belafontes ungläubiger Reaktion auf Trios Adaption seines »Banana Boat Song« in Bio’s Bahnhof (1982); ich selbst kann die tiefe Ratlosigkeit bezeugen, die einen Raum voller amerikanischer Pop-Wissenschaftler auf der MoPOP-Konferenz in Seattle 2017 befiel, als ihnen Udo Lindenbergs »Sonderzug nach Pankow« zugemutet wurde. Es ist also klar, was Schneider meint.
Nun definiert Schneider die Incredibly Strange Music allerdings ganz nach dem Muster von naivem Camp: Sie falle »umso merkwürdiger aus[ ], je weniger sie selbst um ihre Seltsamkeit weiß«, und entstehe überhaupt »ausschließlich absichtslos (willentlich produzierte Incredibly Strange Music gibt es per Definition nicht)«.27 Gedacht ist da ursprünglich an Acts wie The Shaggs. In dieser Art versteht und sammelt Jello Biafra bekanntlich die Musik von Heino. Als er im Interview gefragt wird, ob er ihn mag, antwortet Biafra:
Mögen ist das falsche Wort. Die unheimliche Faszination von Heino kommt nicht daher, dass ich ihn mag. Es geht darum, wie unglaublich schrecklich seine Musik ist. Die ist so grausam! Eine Menge Leute werden verrückt und wütend, wenn sie seine Musik hören, auch wenn sie kein Wort Deutsch können. So hielt ich es zu Zeiten der Dead Kennedys für eine großartige Punk-Sabotage, vor unseren Konzerten Heino-Stücke zu spielen.28
Dass man Schlager vielleicht, wie Schneider, für Incredibly Strange Music halten, ihnen dies aber keinesfalls ästhetisch zugutehalten kann, liegt an der Art des Urteils: »it’s good because it’s awful«, und schrecklich bleibt es durch und durch. Schlager wirken seltsam und darin potentiell ästhetisch interessant nur für den, der sie von einem privilegierten internationalen Pop-Standpunkt aus beurteilt, nicht für seine impliziten Hörer:innen – also, wie Omas Porzellanreh campy wirkt. Und so wenig wie Oma strebt auch Heino in den 1970er-Jahren in irgendeiner Weise nach der Lockerheit von Pop.
Im Gegensatz dazu aber scheinen Udo Lindenberg oder Trio sich zwar einerseits sehr wohl nach dieser Lockerheit zu sehnen, andererseits aber über ein ausgeprägtes Bewusstsein zu verfügen, dass ihr Pop als deutscher prima facie weit von ihr entfernt ist. Nach Schneiders Definition kann er also nicht mehr unter Incredibly Strange Music fallen, es sei denn, man würde eben doch, wie im Camp, auch eine mehr oder weniger bewusst produzierte Variante derselben zulassen. Die ausgestellte Sekundarität, das potentiell Alberne, die radikalen Anführungszeichen, in denen sie ihre Musik gerade dort präsentieren, wo sie sich an den angloamerikanischen Vorbildern messen und abarbeiten, unterscheiden Lindenberg, Nina Hagen, Trio, Ideal und viele andere eben vom Schlager (wie übrigens auch von stumpferen Formen des Punk). Das gilt auch für Bernd Begemann und die Hamburger Schule und mutatis mutandis für zahlreiche Acts bis in die Gegenwart, etwa bei Rammstein, Kraftklub, Bilderbuch oder im Cloud Rap. Das Verkrampftschöne ist hier durchaus bewusst produziert. Das habe ich an anderer Stelle genauer analysiert zum einen an der Sprachmischung in den Lyrics, bei der sich englische und deutsche Textelemente gegenseitig relativieren, zum anderen an der Verwendung von Markennamen, die in deutschen Texten immer komisch wirken und eine Awkwardness des Gesamttextes bewirken.29 Von Beginn an figuriert aber auch der dritte Peinlichkeitsfaktor, der Schlager, im Horizont der deutschen Pop-Musiker:innen, bei Lindenberg mitunter mit ausdrücklichem Bezug auf das 3. Reich. In der Gestalt von Rudi Ratlos, dem älteren bürgerlichen, unbeweglichen Mann mit getönter Hornbrille, wie er 1974 im Video zum gleichnamigen Song dargestellt ist, wird zum einen der NS-Bezug explizit (»Berlin 33«), zum andern aber das aktuelle Schlagerpublikum gleich mitporträtiert (man beachte auch die Tapete im Hintergrund!).30 Das im Schlager Verdrängte wird im Deutschpop ausdrücklich, sobald er sich auf ihn bezieht. Bei Nina Hagen findet sich Ähnliches; in der Neuen Deutschen Welle sind solche Bezüge dann allgegenwärtig – rote Lippen, blaue Augen, La Montanara, Caprifischer und so weiter.
Die These lautet also mit und gegen Frank Apunkt Schneider: Indem bundesdeutsche Pop-Musik explizit Bezug nimmt auf die drei Faktoren Englischsprachiger Pop, Warenform und Schlager, gegenüber denen der eigene Pop-Status sich als notwendig relativer und damit prekärer erweist, pflegt sie aktiv und durchaus bewusst eine Verkrampfungsästhetik. Der Unterschied zu dem, was etwa Heino oder Tony Marshall zeitgleich mit Liedern wie »In einem Polenstädtchen« oder »Schöne Maid« machen, illustriert sinnfällig die eben behauptete Ausdifferenzierung in Pop und Schlager.
5 Urteilsformen am Beispiel des Neoschlagers
Wie sieht das nun bei alledem mit unseren Urteilen aus? Ein Problem ist offenbar schon die ersten Person Plural – welches ›wir‹ urteilt hier? Ich gehe also bewusst erstmal von mir aus: Ich fälle über Schlager ein negatives ästhetisches Urteil, sie entsprechen nicht meinem Geschmack, sie erzeugen Unlust in einem Maße, dass ich sie nur schwer ertragen kann. Ästhetische Urteile sind nach Kant zwar nicht, wie Sachurteile und ethische Urteile, rein begrifflich, das heißt ich kann niemanden dazu zwingen, Schlager unschön zu finden. Sie sind aber auch nicht rein körperlich-sinnlich motiviert, sondern haben Anteil an beiden Vermögen, und auch das scheint mir hier zuzutreffen. Anders als bei Spargel oder Caterina Valente ist es mir nämlich nicht egal, ob andere, an denen mir liegt, solche Schlager mögen oder nicht. Ich sinne, sagt Kant, anderen meine ästhetische Überzeugung an, das heißt ich entwerfe diese von Anfang an auf eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten hin. Diese soziale Dimension des ästhetischen Urteils passt sehr gut zum oben beschriebenen Modus von Pop-Musik-Rezeption nach Diederichsen, die ja auch vom einsamen, individuellen Urteil zur imaginären oder auch realen Stilgemeinschaft führt. Diederichsen sieht darin geradezu das Zentrum dessen, »was wir – im Unterschied zum Populären – Pop nennen: die Möglichkeit, allein zu sein, mutterseelenallein mit der Gesellschaft.«31 In dieser seiner Unterscheidung zwischen Pop und dem Populären steckt, so scheint mir, ein Doppelcharakter von Pop selbst, der eben zugleich als populär-funktionale Unterhaltungs- und Tanzmusik dienen und existentielle Erfahrungen vermitteln, das heißt sowohl als angenehm als auch im definierten Sinne als ästhetisch beurteilt werden kann.
Man wünschte, es wäre anders, doch ich fürchte: Auch der Schlager hat diesen Doppelcharakter als Unterhaltung und Existenzial, den Diederichsen dem Pop zuspricht; und zwar gilt das explizit eben noch nicht für die Unterhaltungsmusik der 1950er, sondern gerade für den bösen Schlager seit den späten 1960ern, der Oma und Rudi ans Herz ging, und es gilt auch für den Neoschlager heute – was erneut bestätigt, dass wir es hier mit einem gemeinsamen Feld zu tun haben.
Nehmen wir Philipp Poisels Neoschlager »Wie soll ein Mensch das ertragen«? (2010) – einen Song, dessen Titel ich (wie das »Es tut weh« der Rattenfänger) nicht anders als selbstreferentiell lesen kann. Aber sieht man sich die Kommentare und Klickzahlen auf YouTube an, dann kann kein Zweifel daran bestehen, dass Millionen von Hörer:innen mithilfe dieses Songs echte existentielle Erfahrungen machen und verarbeiten. »Unfassbar ergreifend und so unglaublich wahr« finden sie es, stehen zu ihren Tränen (selbst Männer!) und denken dabei nicht nur an Liebeskummer, von dem das Lied handelt, sondern auch an krebskranke oder verstorbene Angehörige. Wir müssen also davon ausgehen, dass auch Schlagerfans Geschmack haben, wenngleich leider nicht meinen, sondern eben einen ›schlechten‹. Einen Unterschied bewirkt hier offenbar das allgemeine kulturelle Kapital, mit anderen Worten: Klassenstrukturen oder bessere Bildung. Wer geschmacklich nach Reims zurückkehren will, landet eben nicht beim linken Proletkult, sondern beim Schlager. Hier würde jetzt der begriffliche Anteil meines ästhetischen Urteils zum Tragen kommen, indem ich etwa die aufgesetzte Gefühligkeit und Fake-Authentizität, die peinliche Rollenverteilung, die Klischeehaftigkeit und Ähnliches, des Poisel-Songs und -Auftrittes verbalisieren würde. Das wäre keine ästhetische Kommunikation von Gleich zu Gleich, denn ich würde damit ja behaupten, dass ich ‚gette‘, was den Anderen an diesem Schlager ergreift, und ihn gerade deshalb als Opfer einer Manipulation darstellen kann. Denn dadurch wird der Schlager ja erst böse, was ja kein ästhetisches, sondern ein ethisch-politisches Urteil ist: dass er den Hörer:innen etwas vortäuscht, was er nicht liefert, und diese damit, wie Eco sagt, eine »Lüge« konsumieren lässt.32 Als reine Unterhaltungsmusik war und wäre Schlager harmlos; verwerflich wird es, sobald die existentielle Dimension als ungedeckter Sinnscheck ins Spiel kommt. Ganz ähnlich argumentiert Jan Böhmermann in seinem Eier-aus-Stahl-Feature zu Max Giesinger im NeoMagazin Royale. Er zeigt, wie Giesinger Tiefe, Individualität und Authentizität behauptet für Songs, die tatsächlich kulturindustrielle Massenprodukte sind, die im Wortsinne aus Klischees und Stock-Footage zusammengesetzt wurden und überdies noch Schleichwerbung enthalten. Das ist alles wahr und einleuchtend, aber mit etwas Abstand erinnert es natürlich auch fatal an die alten elitären Standardargumente gegen Pop selbst.
Wie gesagt, eine Rezeptionsweise von Schlager als Incredibly Strange Music setzt ein ähnliches Bildungsgefälle voraus insofern, als dass der oder die Urteilende die Maßstäbe der primären Rezipient:innen nicht teilt, den Schlager also awful findet und gerade daraus ein ästhetisches Vergnügen zieht. Das ist eine Spielart von Camp, und wie Camp allgemein, kann man auch diese Haltung elitär finden, obwohl sie in der Schwulenkultur durchaus emanzipatorisch wirken mag und selbst bei Bad-Taste-Partys politisch eher harmlos bleibt. Was bei dieser uneigentlichen Rezeption allerdings ganz getilgt wird, ist die ethische Dimension, das Böse eben, weil genau die politischen Dimensionen des im Schlager eigentlich entworfenen Möglichkeitsraumes – etwa die spießigen Gender-Strukturen – hier narkotisiert oder sogar unterlaufen werden. Die Camp-Rezeption setzt also etwas in Anführungszeichen, das per se nicht in Anführungszeichen steht.
Anders die Pop-Rezeption: Pop ›getten‹ heißt nämlich, die Anführungszeichen lesen zu können, in denen das Pop-Ding selbst bereits von Anfang an steht. Als genuin ästhetisches Urteil ohne ethisch-epistemologisches Gefälle entwirft es die Gemeinschaften derer, die die Zeichen lesen können, als ausdifferenzierte »Stilgemeinschaften normalisierten Spektakels«,33 deren Mitglieder den entsprechenden Modus kollektiv verinnerlicht haben; etwa wenn der Frontmann von Kreator 2005 auf dem Metal-Festival in Wacken die Menge fragt: »People of Wacken, are you ready to kill each other?«, alle begeistert zustimmen und selbstverständlich alles friedlich bleibt. Wer hier den Aufruf zur Gewalt straight rezipiert, erweist sich als Außenseiter, der schlicht den Modus nicht kapiert hat, der hier am Werk ist (ganz ähnlich wie jener Spiegel-Rezensent, der in Christian Krachts Imperium rechte Tendenzen am Werk sah). Entscheidend ist dabei, dass im ästhetischen Urteil das ›Getten‹ und Gutfinden jeder expliziten Interpretation vorausgeht und damit eben auch jedem begrifflichen Urteil, sei es ein sachliches (x bedeutet y) oder ein ethisch-politisches (x ist gut oder verwerflich). Das Verständnis komplexer Pop-Modi setzt dabei, wie das Beispiel Wacken belegt, nicht zwangsläufig Intellektualität voraus – und es ist ja auch keineswegs so, dass alle Nicht-Abiturient:innen zwangsläufig Schlager hören würden. Zu den großen Mythen des Pop, die wir als solche zwar erkennen, aber auch nicht leichtfertig preisgeben sollten, gehört ja auch die Überwindung von Klassenstrukturen. Was jedoch die Urteilsformen angeht, bleibt festzuhalten: Ästhetische Urteile erfolgen in diesen Kontexten dezidiert vor Sachurteilen und ethischen Urteilen. Etwas spricht uns ästhetisch an, und später erst überlegen einige von uns, nennen wir sie Kulturpoet:innen, welche seiner Eigenschaften daran beteiligt sind und ob das eigentlich auch politisch zu verantworten ist.
Wie kommt es also, dass ich Max Giesinger & Co., ohne sie groß zu kennen, allein sobald sie auf 1Live, WDR 2 oder 4, also in eindeutigem Pop-Kontext, gespielt werden, nicht als popförmig, sondern als Neoschlager höre und ästhetisch negativ beurteile? Im Intro, also bevor die deutsche Stimme einsetzt, kann man manche Songs noch für den Indiepop halten, den sie in der Tat in ihrem Instrumentalteil beerben. Englischen Indiepop kann ich gut hören; es ist also spezifisch der deutschsprachige Gesang, an dem mein Urteil hängt. Allerdings gibt es auch viele deutschsprachige Acts, die ich als Pop und also gern höre; allerdings werden die eher selten im Radio gespielt: Bilderbuch, Die Heiterkeit, Ja, Panik, Messer, Die Nerven, Die Trümmer – um nur einige zu nennen – lösen die ästhetische Abwehrreaktion ›Neoschlager‹ nicht aus.
Auf einem Schlager-Workshop im April 2018 in Münster hat Alan van Keeken auf der Basis einer Feldanalyse die jüngere Entwicklung des Deutschpop etwa in folgender Weise erzählt: Nach dem großen kommerziellen Erfolg von Wir sind Helden im Jahre 2003 seligierte die deutsche Plattenindustrie das Produktformat ›Schülerbandästhetik, vorzugsweise mit Frontfrau‹, und schickte Bands wie Silbermond, Juli, Klee oder Revolverheld ins Studio. Deutschsprachige Pop-Musik wurde durch sie auch ohne Quotenregelung zu einer Normalität im Pop-Radio. In Reaktion auf die Absatzkrise bei den Tonträgern betrieb man aber parallel dazu noch einen aktiven Künstleraufbau, dessen Ergebnis dann die von Böhmermann ridikülisierte Garde von Tim Bendzko, Andreas Bourani, Max Giesinger, Frida Gold, Max Mutzke, Philipp Poisel, Matthias Schweighöfer und anderen ist, also das, was ich Neoschlager nenne. Sie dominieren seit den 2010er-Jahren das Deutschpop-Segment und werden dabei durch ein Netzwerk von Produzent:innen und Songschreiber:innen unterstützt, die oft auch im Schlagerbereich arbeiten.
Blicken wir noch einmal auf den Poisel-Song »Wie soll ein Mensch das ertragen«:34 Die geschlossenen Augen, die bebende Stimme, schon bei der Anmoderation, suggerieren höchste Emotionalität und authentische Ergriffenheit – dabei wird alledem bereits gefühlsverstärkende Musik unterlegt. Die Phrasierung ist teilweise bei Herbert Grönemeyer abgeschaut, auf dessen Grönland-Label Poisel auch publiziert. Die ersten Verse suggerieren in ihrer allegorisch-abstrakten Schwerverständlichkeit in vager Weise ›Kunst/Hochkultur‹, zugleich ist mit dem falschen Imperativ »Werf’ dich« aber eine bildungsferne Volksnähe garantiert. Die Bilder ergeben keinen rechten Zusammenhang, ja wirken gelegentlich geradezu katachrestisch: Das Gegenüber soll sich in „jeden meiner Schritte“ werfen, damit das Ich für es irgendwo hin tanzen kann – wozu das gut sein soll, bleibt rätselhaft. Verse wie »Hab’ so oft bei schwerem Gewitter / In deine Hände geweint« sind ausgesprochen schlecht: Die Gewitter-Allegorie passt weder zum iterativen »so oft« noch zur suggerierten körperlichen Nähe, die die Allegorie wieder einzieht und überdies als Hochkitsch gestaltet ist: shelter from the storm, ok, aber habituell in die Hände von jemand anderem weinen? Der Refrain belastet das alles mit einer existenziellen Schwere, die das Humanum an sich betrifft. Insgesamt bleibt eher unklar, wovon der Song eigentlich genau handelt, aber gerade in dieser Vagheit ist er multipel anschlussfähig an jede Art von emotionaler Belastung in Beziehungen. Er transportiert, positiv gesprochen, eine nicht gegenderte emotionale Verletzlichkeit, an der aber dann doch, wie die Anmoderation nahelegt, irgendwie irgendwer anders schuld ist. (Da wird man ja wohl noch mal verletzt sein dürfen!)
Was dem Song aber vollständig abgeht, ist die »Anmut und Würde der Verkrampfung«. Er bedient souverän die musikalische und emotionale Tastatur. Für seinen impliziten Hörer ist es nicht, wie Diederichsen es für Pop-Musik behauptet, »konstitutiv unentscheidbar, ob der Protagonist eine wirkliche oder eine erfundene Figur ist«,35 und auch sonst bleibt zwar viel vage, aber nichts ambig. Der Song gibt sich vollkommen authentisch36 – der Verdacht, seine Emotionalität könnte eine über Kunstmittel hergestellte sein, bleibt ebenso außen vor, wie der der Kommerzialität und der Sekundarität gegenüber ›echtem‹ Pop. Nichts geschieht hier in Anführungszeichen: Das Englische ist längst der neuen Norm des Deutschen gewichen und die Nähe zum Schlager zur unmarkierten Ununterscheidbarkeit geworden; Böhmermann konstatiert ein »Revival des Schlagers unter falscher Flagge«.37 So sehr man sich vor generalisierten Verdikten hüten muss – schematische, serielle Produktion und Marktförmigkeit sind wie gesagt schon immer topische Vorwürfe gegen kulturindustrielle Produkte im allgemeinen und Pop-Musik im Besonderen –; für den historisch konkreten Fall von Giesinger, Poisel & Co. hat Böhmermann mit seiner Kritik recht. Wenn Trio oder Andreas Dorau ein Liebeslied sangen oder Tocotronic oder Bilderbuch das heute tun, dann wird und wurde immer auch darum gerungen, ob und unter welchen Bedingungen man das auf Deutsch überhaupt machen kann. Der Mythos einer unverkrampften deutschen Pop-Musik des 21. Jahrhunderts jedoch verdrängt diese Ebene und tut so, als sei man unmittelbar zum Pop. Es ist gerade das vermeintlich Unverkrampfte dieser neuen deutschen Pop-Musik, die Tatsache, dass ihr das Verhältnis zum englischsprachigen Pop beziehungsweise umgekehrt zu ihrer eigenen Deutschheit, zur eigenen Warenform und zum Schlager selbst nicht zum Problem wird, das sie so schwer erträglich macht.
Stimmt das auch? Der Titel von Poisels Album Mein Amerika (2017), 13 Wochen auf Platz 1 der deutschen Album-Charts, lässt immerhin eine Reflexion in die eben bestrittene Richtung erwarten. Pop ist seit Leslie Fiedler ja in gewisser Weise immer auch die Antwort auf die Frage ›Was ist unser Amerika?‹ Die kurze Gegenprobe ergibt jedoch, dass Poisel sich hier keineswegs produktiv mit dem Mutterland des Pop auseinandersetzt, im Gegenteil:
So wie ein Sommer in der Wüste
Wie bei Woodstock mittendrin
Tiefe Wälder, kalte Meere
In deinen Armen fühle ich mich frei
Ich bin, ich bin dein
Und du bist, du bist mein
Tag in jedem Jahr
Du bist mein, bist mein Amerika
›Mein Amerika‹, das ist die heteronormative deutsche Beziehung, du bist mîn, ich bin dîn, des solt dû gewis sîn. Bildspender ist allein die große amerikanische Landschaft. Selbst Woodstock wird nicht als Gegenkultur beerbt, sondern als ozeanisches Gefühl, das man bequem zuhause und im Privaten haben kann. Diese schöne Einsicht entfaltet sich über einem coldplayesken Gitarrenteppich, der in seiner emotionalen Wirkung bereits als Indie-Sekundärzeichen eines Neoschlager-Midcults fungieren kann und im Refrain in U2-artiges Pathos gesteigert wird. Das erinnert in seinem Effekt doch sehr an jene Schlager-Versionen internationaler Hits in den 1960ern, die alles potentiell Widerständige des Originals einebneten: »Schön, ja so schön sind die Mädchen zu Haus«. Damit hat die Gegenprobe meine These bestätigt.
6 Und was ist daran nun politisch?
Meiner Kompetenz gemäß habe ich versucht, rein im Ästhetischen zu argumentieren, das heißt ich rede noch gar nicht von den politischen Implikationen dieser neuen deutschen Selbstverständlichkeit, wie sie bereits seit Mitte der Nuller Jahre von der I Can’t Relax in Deutschland-Initiative kritisiert wurden.38 Die Geschichte einer Normalisierung des Deutschen im Pop über die Quotendebatten, die Mia.-Affäre 2003, die Kampagne »Du bist Deutschland« 2005/2006 und die WM 2006 ist immer wieder erzählt worden. Und dass wir heute die AfD im Bundestag haben und Neoschlager im Pop-Radio, scheint allen Befürchtungen recht zu geben. Wie solche vermeintlichen Evidenzen methodologisch einzuholen wären, ist allerdings weit weniger klar. Immerhin ist es interessant, dass schon die Aktion I Can‘t Relax in Deutschland mit der Unmöglichkeit von Entspannung ebenfalls das Thema des Verkrampften oder doch zumindest Wachsam-Unentspannten angesichts eines wieder aufkeimenden Nationalismus in den Mittelpunkt stellt. Die Einleitung zum Textband stellt klar: »Dass es uns – wie der Titel nahelegt – nicht möglich ist, in Deutschland zu relaxen, soll nicht den Wunsch vermitteln, dies nun doch endlich wieder zu können.«39 Wie das politisch gemeint ist, ist evident. Semiotisch könnte man es im Licht des Gesagten vielleicht wie folgt reformulieren: Das Prätendieren eines entspannten deutschen Pop, der die Reflexion seiner prekären Ursprungs- und Kontextverhältnisse nicht mehr leistet, setzt die deutsche Identität in Form eines mythischen Zeichens, also als etwas natürlich Gegebenes. Das Böse daran, und das wäre die Brücke zum Politischen, ist nicht die Identität, sondern deren Nicht-Paradigmatik, ihre Alternativ- und Geschichtslosigkeit als vermeintliche Natur. Wenn Poisel suggeriert, Woodstock seien wir selbst, ist eben nichts Alternatives mehr im Spiel. Und es ist mein Geschmack, der mir sagt: Das ist nicht Pop, denn hier ist etwas ganz falsch; der Modus stimmt nicht, es fehlen jene Anführungszeichen, die zumindest im deutschen Sprachraum immer pop-konstitutiv waren. Wer das, wie offenbar die Verantwortlichen beim WDR, anders sieht, der hat womöglich von Pop insgesamt einen ganz anderen Begriff als ich – zumindest aber einen ganz anderen Geschmack. Geschmack aber ist das Vermögen zu ästhetischen Urteilen, und ästhetische Urteile haben politische Folgen, weil sie die Kraft haben, Stilgemeinschaften zu konstituieren und damit Möglichkeiten zu entwerfen, wie wir leben wollen.
Wie kann es uns aber gelingen, in unserer Rede über den Schlager nicht die alten Fehler zu wiederholen, die insbesondere die Kulturkritik Frankfurter Schule gemacht hat? Der Unterschied des Schlagers zum Pop liegt, soviel ist sicher, nicht in seiner kommerziellen Gestalt, und er ist vermutlich auch letztlich nicht auf seine musikalische Form zurückzuführen. Wie der Pop, so hat sich auch der deutsche Schlager überdies enorm ausdifferenziert, jedes Urteil wäre unbedingt historisch genauer zu situieren, und es scheint hier wie dort inzwischen nahezu unmöglich, generelle Aussagen zu treffen, zu denen uns nicht sofort auch Gegenbeispiele einfallen würden. Und insbesondere die sekundären Aneignungen des Schlagers sollen hier keinesfalls von vornherein diskreditiert werden. Dennoch müssen wir die Herausforderung annehmen, und ich glaube, wir tun das nicht, wenn wir im Zuge einer falsch verstandenen Elitismus-Vermeidung an seiner Ehrenrettung arbeiten.
Von einem gewissen Zeitpunkt in den 1960er-Jahren an bildet der Schlager ein gemeinsames System mit dem Pop und definiert sich folglich als das, was Pop ihm zu bedeuten übriggelassen hat. »[J]edes System«, schrieb Hermann Broch in seinen Reflexionen über den Kitsch, »ist dialektisch fähig, ja sogar gezwungen, sein Anti-System zu entwickeln, und die Gefährlichkeit ist umso größer, als für den ersten Blick System und Anti-System einander aufs Haar gleichen und nicht bemerkt wird, daß jenes offen und dieses geschlossen ist.«40 Es hat lange genug gedauert, bis wir Pop als die neue bürgerliche Kunst der offenen demokratisch-marktwirtschaftlichen Gesellschaften nach westlichem Muster erkennen und ernstnehmen konnten. In einer Zeit, wo wesentliche Errungenschaften dieser Gesellschaften durch ihr Anti-System von innen heraus bedroht erscheinen wie seit Jahrzehnten nicht, steht, wie ich meine, eine intensivere Beschäftigung mit dem Bösen im ästhetischen System des Pop zu Recht auf der Tagesordnung.
Literaturverzeichnis
AMÉRY, Jean: Hand an sich legen. Diskurs über den Freitod. Stuttgart 1976.
BAßLER, Moritz: »In der Raupenbahn. 1967, die neuen Pop-Paradigmen und ihre Rezeption in Deutschland«. In: Gerhard Kaiser u. a. (Hg.): Younger Than Yesterday. 1967 als Schaltjahr des Pop. Berlin 2017, S. 218–235.
BAßLER, Moritz »Watch out for the American subtitles! Zur Analyse deutschsprachiger Popmusik vor angelsächsischem Paradigma«. In: Text + Kritik 10 (2003), Sonderband: Pop-Literatur. Hg. v. Heinz Ludwig Arnold u. Jörgen Schäfer. München 2003, S. 279–292.
BAßLER, Moritz: Western Promises: Pop-Musik und Markennamen. Bielefeld 2019.
BEHREND, Roger u. Martin Büsser: I Can’t Relax in Deutschland. Köln 2005.
BROCH, Hermann: Schriften zur Literatur 2: Theorie [1950]. Frankfurt / M. 1975.
CLAUDUS 1943: »France Gall - Ein bißchen Goethe, ein bißchen Bonaparte«. YouTube, 24. Mai 2010. https://www.youtube.com/watch?v=p9g4Md_huII (zuletzt eingesehen am 30. April 2021).
DIEDERICHSEN, Diedrich: Über Pop-Musik. Köln 2014.
ECO, Umberto: »Die Struktur des schlechten Geschmacks.« In: Ders. (Hg.): Apokalyptiker und Integrierte. Zur kritischen Kritik der Massenkultur [1964]. Frankfurt / M. 1986.
FASCHER, Horst: Let The Good Times Roll! Der Star-Club-Gründer erzählt. Hg. v. Oliver Flesch. Frankfurt / M. 2006.
FRITZ5107: »Heino – Karamba, Karacho, ein Whisky 1972«. YouTube, 10. März 2017. https://www.youtube.com/watch?v=1Gn_bx77SaA (zuletzt eingesehen am 30. April 2021).
FRITZ51224: »Roy Black & Anita - Schön ist es, auf der Welt zu sein 1971«. YouTube, 9. November 2008. https://www.youtube.com/watch?v=k0cXrif6OQQ (zuletzt eingesehen am 30. April 2021).
FRITZ51230: »Heino - Blau blüht der Enzian 1972«. YouTube, 5. März 2017. https://www.youtube.com/watch?v=8-2asjlBFIs (zuletzt eingesehen am 30. April 2021).
FRITZ5163: »Tina York - Wir lassen uns das Singen nicht verbieten 1974«. YouTube, 4. Mai 2009. https://www.youtube.com/watch?v=OAex3wGE7ik (zuletzt eingesehen am 30. April 2021).
FRITZ5164: »Dunja Rajter & Rudi Carrell - Zimmermädchen und Hotelgast 1971«. YouTube, 16. Dezember 2012. https://www.youtube.com/watch?v=kx3YSIKmHLg&t=90s (zuletzt eingesehen am 30. April 2021).
FRITZ5165: »Tony Marshall - Schöne Maid 1971«. YouTube, 16. Dezember 2012. https://www.youtube.com/watch?v=17Vi5nckNkk (zuletzt eingesehen am 30. April 2021).
HACKETT, Pat u. Andy Warhol: POPism. The Warhol 60s. New York 1980.
IHLE, Christian: »Don’t Mention The War (40): Dead Kennedys Jello Biafra über Heino und die Toten Hosen«. 2. September 2016. https://blogs.taz.de/popblog/2015/09/02/dont-mention-the-war-40-dead-ken... (zuletzt eingesehen am 30. April 2021).
KANT, Immanuel: Kritik der Urteilskraft. Hg. v. Gerhard Lehmann. Stuttgart 1976.
MANIA, Thomas: »Schlager! – die neue Leichtigkeit alten Kulturgutes.« In: Ders. u. a. (Hg.): 100 Jahre deutscher Schlager! Münster 2014, S. 7–17.
POISEL, Philipp: »Liebeskummer ist ›ein starker Motor‹«, 22. Februar 2017. www.gala.de/stars/interview/philipp-poisel-liebeskummer-ist--ein-starker... (zuletzt eingesehen am 30. April 2021).
REISLOH, Jens: Deutschsprachige Popmusik: Zwischen Morgenrot und Hundekot. Von den Anfängen um 1970 bis ins 21. Jahrhundert. Grundlagenwerk – Neues Deutsches Lied (NDL). Münster 2011.
SCHATZ, Thorsten u. Michael Fuchs-Gamböck: Jetzt und wir. Neue deutsche Bands zwischen Soundcheck und Lebensgefühl. München 2008.
SCHNEIDER, Frank Apunkt: Deutschpop halt’s Maul! Für eine Ästhetik der Verkrampfung. Mainz 2015.
SONTAG, Susan: »Notes on ›Camp‹« [1964]. In: Dies.: Against Interpretation and other Essays. London 2001, S. 275–292.
SUPERJG72: »Philipp Poisel – Wie soll ein Mensch das ertragen...«. YouTube, 11. Februar 2013. https://www.youtube.com/watch?v=9qGJ09aiPHU (zuletzt eingesehen am 30. April 2021).
TERKESSIDIS, Mark: »Die Eingeborenen von Schizonesien. Der Schlager als deutscheste aller Popkulturen.« In: Tom Holert u. ders. (Hg.): Mainstream der Minderheiten. Pop in der Kontrollgesellschaft. Berlin, Amsterdam 1996, S. 115–138.
LINDENBERG, Udo – UTube: »Udo Lindenberg - Rudi Ratlos (offizielles Video von 1974)«. YouTube, 20. Oktober 2015. https://www.youtube.com/watch?v=S3xga9mDADU (zuletzt eingesehen am 30. April 2021).
VENUS, Jochen: »Die Erfahrung des Populären. Perspektiven einer kritischen Phänomenologie«. In: Marcus S. Kleiner u. Thomas Wilke (Hg.): Performativität und Medialität Populärer Kulturen. Theorien, Ästhetiken, Praktiken. Wiesbaden 2013, S. 49–73.
WASSERMELONE: »Heino – Caramba, Caracho ein Whisky«. YouTube, 19. Juni 2017. https://www.youtube.com/watch?v=ytEBtOfNPuI (zuletzt eingesehen am 30. April 2021).
ZDF MAGAZIN ROYALE: »Eier aus Stahl. Max Giesinger und die deutsche Industriemusik | NEO MAGAZIN ROYALE«. YouTube, 6. April 2017. www.youtube.com/watch?v=nFfu2xDJyVs (zuletzt eingesehen am 30. April 2021).
- 1. Jens Reisloh: Deutschsprachige Popmusik: Zwischen Morgenrot und Hundekot. Von den Anfängen um 1970 bis ins 21. Jahrhundert. Grundlagenwerk – Neues Deutsches Lied (NDL). Münster 2011, S. 85f.
- 2. Ebd., S. 89f. Die Liedermacher schlägt er dagegen pauschal dem NDL zu.
- 3. Thorsten Schatz u. Michael Fuchs-Gamböck: Jetzt und wir. Neue deutsche Bands zwischen Soundcheck und Lebensgefühl. München 2008, S. 7f.
- 4. Vgl. den Ausstellungsplan: Thomas Mania: »Schlager! – die neue Leichtigkeit alten Kulturgutes«. In: Ders. u. a. (Hg.): 100 Jahre deutscher Schlager! Münster 2014, S. 7–17, hier S. 15.
- 5. Immanuel Kant: Kritik der Urteilskraft. Hg. v. Gerhard Lehmann. Stuttgart 1976, § 8, S. 84.
- 6. Ebd. § 8, S. 88.
- 7. Horst Fascher: Let The Good Times Roll! Der Star-Club-Gründer erzählt. Hg. v. Oliver Flesch. Frankfurt / M. 2006, S. 57.
- 8. Moritz Baßler: »In der Raupenbahn. 1967, die neuen Pop-Paradigmen und ihre Rezeption in Deutschland«. In: Gerhard Kaiser u. a. (Hg.): Younger Than Yesterday. 1967 als Schaltjahr des Pop. Berlin 2017, S. 218–235, hier S. 235.
- 9. Pat Hackett u. Andy Warhol: POPism. The Warhol 60s. New York 1980, S. 39f.
- 10. Die zahlreichen englischen Pseudonyme, die sich die Schlagersänger und -sängerinnen in den 1960er-Jahren zulegten, belegen, dass man durchaus registriert, das sich dort gerade etwas tut. Zugleich kann aber der fremdländische Kick genau so gut auch über einen französischen, osteuropäischen oder gar niederländischen Akzent hereingeholt werden.
- 11. Jean Améry: Hand an sich legen. Diskurs über den Freitod. Stuttgart 1976, S. 17f.
- 12. Susan Sontag: »Notes on ›Camp‹« [1964]. In: Dies.: Against Interpretation and other Essays. London 2001, S. 275–292, hier S. 287.
- 13. Ebd., S. 292.
- 14. Anfang der 1980er-Jahre publiziert die Titanic eine Art Wörterbuch zur Decodierung von Schlagertexten, das etwa so geht: »Du in meinem Arm« lies »Mein Arm in dir«.
- 15. Claudus 1943: »France Gall – Ein bißchen Goethe, ein bißchen Bonaparte«. YouTube, 24. Mai 2010. https://www.youtube.com/watch?v=p9g4Md_huII (zuletzt eingesehen am 30. April 2021).
- 16. fritz51224: »Roy Black & Anita - Schön ist es, auf der Welt zu sein 1971«. YouTube, 9. November 2008. https://www.youtube.com/watch?v=k0cXrif6OQQ (zuletzt eingesehen am 30. April 2021), ab Minute 1:40.
- 17. fritz5164: »Dunja Rajter & Rudi Carrell - Zimmermädchen und Hotelgast 1971«. YouTube, 16. Dezember 2012. https://www.youtube.com/watch?v=kx3YSIKmHLg&t=90s (zuletzt eingesehen am 30. April 2021).
- 18. Dass auch im internationalen Pop tatsächlicher Missbrauch an der Tagesordnung war, etwa im Umfeld von Saviles Top of the Pops, steht auf einem anderen Blatt – hier geht es um Repräsentationsstrukturen.
- 19. fritz5165: »Tony Marshall – Schöne Maid 1971«. YouTube, 16. Dezember 2012. https://www.youtube.com/watch?v=17Vi5nckNkk (zuletzt eingesehen am 30. April 2021).
- 20. Mark Terkessidis: »Die Eingeborenen von Schizonesien. Der Schlager als deutscheste aller Popkulturen«. In: Tom Holert u. ders. (Hg.): Mainstream der Minderheiten. Pop in der Kontrollgesellschaft. Berlin / Amsterdam 1996, S. 115–138, hier S. 117f.
- 21. fritz51230: »Heino - Blau blüht der Enzian 1972«. YouTube, 5. März 2017. https://www.youtube.com/watch?v=8-2asjlBFIs (zuletzt eingesehen am 30. April 2021).
- 22. fritz5107: »Heino - Karamba, Karacho, ein Whisky 1972«. YouTube, 10. März 2017. https://www.youtube.com/watch?v=1Gn_bx77SaA (zuletzt eingesehen am 30. April 2021).
Noch deutlich ältlicher, bürgerlicher und verklemmter wirkt Heinos Publikum in einer anderen Aufnahme dieses Songs: Wassermelone: »Heino - Caramba, Caracho ein Whisky«. YouTube, 19. Juni 2017. https://www.youtube.com/watch?v=ytEBtOfNPuI (zuletzt eingesehen am 30. April 2021).
- 23. fritz5163: »Tina York - Wir lassen uns das Singen nicht verbieten 1974«. YouTube, 4. Mai 2009. https://www.youtube.com/watch?v=OAex3wGE7ik (zuletzt eingesehen am 30. April 2021).
- 24. Frank Apunkt Schneider: Deutschpop halt’s Maul! Für eine Ästhetik der Verkrampfung. Mainz 2015.
- 25. Ebd., S. 105f. et passim.
- 26. Ebd., S. 34.
- 27. Ebd., S. 33.
- 28. Christian Ihle: »Don’t Mention The War (40): Dead Kennedys Jello Biafra über Heino und die Toten Hosen.«, 2. September 2016. https://blogs.taz.de/popblog/2015/09/02/dont-mention-the-war-40-dead-ken...(zuletzt eingesehen am 30. April 2021).
- 29. Vgl. Moritz Baßler: »Watch out for the American subtitles! Zur Analyse deutschsprachiger Popmusik vor angelsächsischem Paradigma«. In: Text + Kritik 10 (2003). Sonderband: Pop-Literatur. Hg. v. Heinz Ludwig Arnold u. Jörgen Schäfer. München 2003, S. 279–292. Ders.: Western Promises: Pop-Musik und Markennamen. Bielefeld 2019.
- 30. Udo Lindenberg – UTube: »Udo Lindenberg - Rudi Ratlos (offizielles Video von 1974)«. YouTube, 20. Oktober 2015. https://www.youtube.com/watch?v=S3xga9mDADU (zuletzt eingesehen am 30. April 2021). – Wer’s nicht glaubt, vergleiche das zweite Heino-Video aus Anmerkung 22.
- 31. Diedrich Diederichsen: Über Pop-Musik. Köln 2014, S. 19.
- 32. Umberto Eco: »Die Struktur des schlechten Geschmacks«. In: Ders. (Hg.): Apokalyptiker und Integrierte. Zur kritischen Kritik der Massenkultur [1964]. Frankfurt / M. 1986, S. 59–115, hier S. 90.
- 33. Jochen Venus: »Die Erfahrung des Populären. Perspektiven einer kritischen Phänomenologie«. In: Marcus S. Kleiner u. Thomas Wilke (Hg.): Performativität und Medialität Populärer Kulturen. Theorien, Ästhetiken, Praktiken. Wiesbaden 2013, S. 49–73.
- 34. Ich beziehe mich auf diesen Live-Auftritt: SuperJg72: »Philipp Poisel - Wie soll ein Mensch das ertragen....«. YouTube, 11. Februar 2013. https://www.youtube.com/watch?v=9qGJ09aiPHU (zuletzt eingesehen am 30. April 2021).
- 35. Diederichsen: Über Pop-Musik (Anm. 31), S. 141.
- 36. Frage im Gala-Interview: »Glauben Sie, dass man mit Liebeskummer die besten Liebeslieder schreibt?«Philipp Poisel: »Es ist auf jeden Fall ein starker Motor. Ich habe jedenfalls viele Songs geschrieben, als ich Liebeskummer hatte. ›Wie soll ein Mensch das ertragen‹, zum Beispiel.« Poisel, Philipp: »Liebeskummer ist ›ein starker Motor‹«. 22. Februar 2017. www.gala.de/stars/interview/philipp-poisel-liebeskummer-ist--ein-starker... (zuletzt eingesehen am 30. April 2021).
- 37. Jan Böhmermann: ZDF MAGAZIN ROYAL: »Eier aus Stahl. Max Giesinger und die deutsche Industriemusik | NEO MAGAZIN ROYALE«. YouTube, 6. April 2017. www.youtube.com/watch?v=nFfu2xDJyVs (zuletzt eingesehen am 30. April 2021).
- 38. Vgl. Roger Behrend u. Martin Büsser: I Can’t Relax in Deutschland. Köln 2005.
- 39. Ebd., S. 14.
- 40. Hermann Broch: Schriften zur Literatur 2: Theorie [1950]. Frankfurt / M. 1975, S. 158–173; S. 169.

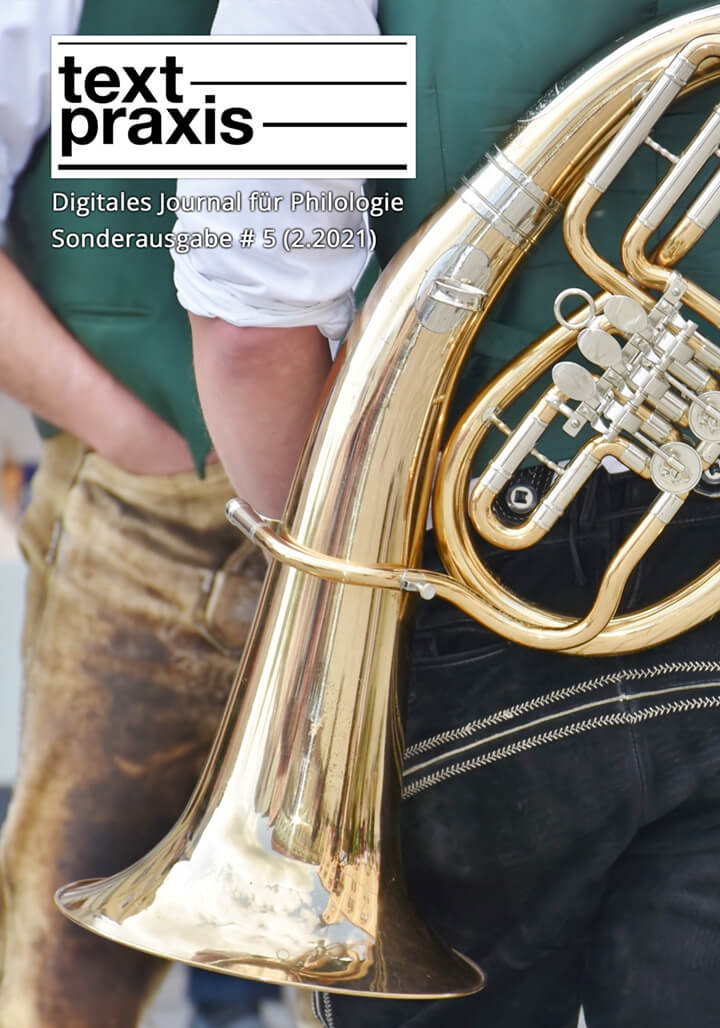

Add comment