Digital Journal for Philology
Konzepte, Korpora und die Quelloffenheit der Kunst
I. Einleitung: Entwicklungen und Tendenzen
2021 konstatiert Thorsten Ries in seinem Beitrag zum Text + Kritik-Sonderband Digitale Literatur II:
Digitale Literatur steht auf der Agenda der Literaturwissenschaft im deutschsprachigen Raum, ein systematisches Forschungsprogramm ist hingegen derzeit ein Desiderat. […] Digitale Literatur im deutschsprachigen Raum weist eine reiche, weit zurückgehende Geschichte und eine bis heute höchst aktive und einflussreiche Produktion auf, auch wenn die Szene das stetige Wachstum der internationalen elektronischen Literatur im Zeitraum vom Ende der 1990er bis Mitte der 2010er Jahre nicht mitvollzogen hat. Die germanistische Forschung hat den Gegenstand bislang – weitgehend ignoriert.1
Mit Blick auf Forschung und Lehre an deutschen Universitäten kann Ries zum jetzigen Zeitpunkt zumindest verallgemeinernd noch zugestimmt werden: »Digitale Literatur stellt eine Herausforderung für die Literaturwissenschaft dar, für grundlegende Kategorien wie den Text- und Literaturbegriff, für die Praxis der Analyse und Interpretation, für die Literaturgeschichte wie auch für die Archivwissenschaft.«2 Ein Blick in das Tagungsprogramm des Germanistentags 2022, auf dem der dem vorliegenden Beitrag zugrunde liegende Vortrag gehalten wurde, zeigt jedoch, dass diese ›Herausforderung‹ angenommen wurde: Digitale, ›neumediale‹ Formen des Erzählens, Erschaffens von und Partizipierens an Literatur ein Jahr nach Erscheinen von Ries' Beitrag sind im wissenschaftlichen Diskurs präsent.3 Diese Befunde zur digitalen Literaturwissenschaft gelten nicht weniger für ›digitale‹ Literatur die z. B. sogenannte ›Künstliche Intelligenz‹,4 Programme, Algorithmen und gerade auch ›zweckentfremdete‹ Prozesse als Kreativitäts- und Kreationswerkzeuge appliziert.5 Besonders seit der Markteinführung von ChatGPT ist auch digital generierte ›Literatur‹ im Bewusstsein eines wenngleich skeptischen Massenpublikums angekommen – hier allerdings zumeist als Bedrohung ›menschlicher‹, vermeintlich kreativerer Textproduktion. Wie auch die Entwicklung digitaler Methoden und Techniken in der Literaturwissenschaft, muss auch die Definition der ›digitalen Literatur‹ selbst als Potenzial, nicht als Gefahr begriffen werden – und als Momentaufnahme eines kontinuierlichen, von außerliterarischen Praktiken und Entwicklungen bedingten Prozesses. Dieser Prozess ist
historisch im Fluss, bedingt durch den technologischen Wandel, der digitale Literaturformen ermöglicht beziehungsweise veralten lässt (etwa in Gattungen wie Netzliteratur, Flash-basierter ›flash e-lit‹ etc.), sowie durch den Prozess der internen Differenzierung nach medienkünstlerischen Form- und Konzeptaspekten (etwa in Form von Hypertext-Literatur, Cyberpoetry, New Media Poetry, Quellcode-Kunstwerken: Codeworks, Code als konkretes Konzeptkunstwerk) und schließlich durch an literarische Gattungsbestimmungen angelehnte Formaspekte (etwa in Electronic Poetry, Code Poetry, digitale Poesie, digitale Dichtung).6
Dieser Wandel im mediengeschichtlichen Hintergrund und den technologischen Voraussetzungen digitaler Literatur(-produktion, -publikation und -rezeption) spiegelt sich auch in den zwei Text + Kritik-Sonderbänden wider, die sich mit digitaler Literatur auseinandersetzen: 2001 erscheint der erste, von Roberto Simanowski herausgegebene Band;7 genau zwei Dekaden später erscheint Digitale Literatur II, herausgegeben von Annette Gilbert und Hannes Bajohr.8
Einer der Herausgeber, Hannes Bajohr, wird in diesem Aufsatz nicht bloß als Literaturtheoretiker und -wissenschaftler relevant, sondern vor allem selbst als ›Autor‹ digitaler Texte. Mit seinem Gedichtband Halbzeug. Textverarbeitungen soll im Folgenden eine Sammlung digitaler Lyrik besprochen werden, die einerseits als ein interessantes Fallbeispiel zeitgenössischer algorithmengestützter ›Computerdichtung‹ gelesen werden kann.9 Andererseits steht Halbzeug geradezu paradigmatisch für den Wandel nicht nur in der Literaturproduktion, sondern auch in der Verfügbarkeit digitalen Textmaterials, der sich zwischen der Veröffentlichung beider Text + Kritik-Bände vollzog: In diesem 20 Jahren
schufen die digitale Verfügbarkeit von Texten und die neuen Techniken der Textverarbeitung und -veröffentlichung die Voraussetzung für das mühelose Kopieren, Bearbeiten und Publizieren großer Textmengen und die schnelle und preiswerte Herstellung von Büchern, auch im Selbstverlag und damit unabhängig von den Leitlinien in der Verlagslandschaft und bis dato gültigen Normen und Werten im literarischen Feld.10
Gerade dies liefert auch die elementare Voraussetzung für Halbzeug, das in einem produktiven, botschaftstragenden Spannungsfeld zwischen Tradition und Innovation steht: Einerseits handelt es sich hier um digitale Korpuslyrik, die digitale Prozesse und Programme experimentell nutzt, um vorhandenes – digital verfügbares – Textmaterial kreativ zu verfremden und auf dieser Basis neue Gedichte zu schaffen. Das Fundament seiner Poetik und der Verfremdungsprozesse liegt aber gleichzeitig in geradezu ›klassischen‹, einst avantgardistischen oder experimentellen Schreibweisen der Textappropriation.11 Dieses vermeintliche Spannungsfeld, das sich zwischen literarischen Traditionen und gegenwärtigen Strömungen aufspannt, steht im Zentrum dieses Beitrages, der anhand von Beispielanalysen die konkrete Umsetzung sowie die Potenziale und Spielarten digitaler Lyrik(-produktion) umreißen und die hierüber sichtbar werdenden Implikationen dieser Spielart digitaler Literaturproduktion herausarbeiten will.
II. Halbzeug. Eine Verortung
Hierzu zunächst eine erste Verortung: Bei Halbzeug handelt es sich nicht um einen primär inhalts-, rezeptions- oder publikationsseitig ›digitalen‹ Text. Es muss hier also die Grenze gezogen werden zur Netzliteratur, literarischen Texten, die bspw. den discours von Social Media zum Erzählen nutzen, auf Blogs, Instagram, Reddit, Tiktok (oder auf einem anderen, bei Erscheinen dieses Beitrags bereits wieder veralteten Dienst) erzählt wurden oder die Moden, Themen und Diskurse des Digitalen Raums in der histoire aufgreifen.12 Ebenso ist Halbzeug zu unterscheiden von anderen Spielarten der digitalen Literatur, die die vielfältigen Möglichkeiten von multimedialen, interaktiven Websites, Programmen, Hypertext oder der Darstellung und Ausführung von Code nutzen:
Der digitale Textbegriff ist gegenüber der an statische Text- und Distributionsmedien gebundenen Literatur erweitert und umfasst neben im digitalen Medium performierten literarischen Text Hypertexte, Literatur in Form von Bild, Video und Ton, textgenerierende Algorithmen und KI-Modelle sowie deren Output und literarischen Programmcode. Nicht alle Anteile eines Werks der digitalen Literatur sind notwendigerweise im gewohnten Sinne textförmig, vielmehr kann die Lektüre entweder »nontrivial effort«, Interaktion oder konzeptionell-technisches Verständnis seitens der Leser*innen erfordern – so etwa im Fall von Jaromils »forkbomb« (2002), einer Zeichenfolge, deren Ausführung auf Unix-Systemen einen Systemabsturz zur Folge hatte.13
Halbzeug wurde im Gegensatz dazu geradezu ›altmodisch‹ auf den analogen Literaturmarkt und ans Lesepublikum gebracht: 2018 erschien Halbzeug in Buchform, noch dazu bei Suhrkamp, also einem der renommiertesten, selbst bereits ›kanonischen‹ Häuser des deutschsprachigen Literaturbetriebs.14 Dies mag einerseits als weiter voranschreitende ›Nobilitierung‹ digitaler Literatur lesbar sein – eine Publikation als klassisches Buch, als Tinte auf Papier, verzichtet aber gleichzeitig größtenteils auf die ansonsten durchaus mögliche Intermedialität und Hypertextualität des digitalen Raums.
Gerade der Kontrast zwischen Veröffentlichung und Entstehung der Texte ist aber nicht uninteressant, verweist er doch auf das übergreifende Spannungsfeld von Tradition und Innovation: Halbzeug integriert das Digitale vor allem auf der Ebene des Produktionsprozesses. Der Band beinhaltet über 40 ›Gedichte‹. Das ›Gedichte‹ muss hier allerdings, zumindest aus Perspektive traditionell ausgerichteter Gattungspoetik, in Anführungszeichen gelesen werden. Bei den Texten in Halbzeug handelt es sich um »generative Codeliteratur«,15 genauer: um digitale korpusbasierte Poesie, also um »Lyriktexte […], die aus vorgefundenem Material und mithilfe von Algorithmen ›generiert‹ worden sind«16 – wobei einzelne der Gedichte genau genommen nicht durch zielgerichtet konzipierte Algorithmen erzeugt wurden, sondern alternativ zweckentfremdete Programme und Prozesse nutzen, um etwaige Ungenauigkeiten, Übertragungsfehler, ›glitches‹ als Kreativtool zu nutzen. Bei diesen Texten handelt es sich somit auch um digitale Appropriationen, also um die »Aneignung fremder Texte/Bücher, vorzugsweise literarischer oder geistesgeschichtlicher Werke«.17 Halbzeug reflektiert so auch über die ohnehin vage Definition von ›Lyrik‹ im Speziellen wie auch die von Literatur, ›Sinn‹ und Autorschaft im Allgemeinen – und hybridisiert und subvertiert diese.18 Apropos Autorschaft: Bei den Gedichten in Halbzeug handelt es sich somit auch nicht um Texte einer generativen ›künstlichen Intelligenz‹ à la ChatGPT oder darauf basierender Software, die auf Anfrage mehr oder minder passgenaue, ›intelligent‹ wirkende Antworten generieren kann.19 Die Halbzeug-Lyrik wurde stattdessen anhand einer Vielzahl letztlich regelbasierter, geradezu mechanischer Prozesse erzeugt.
Im Falle von textgenerierenden KIs erzeugen – vereinfacht gesagt – von außen zunächst undurchschaubare, auf diesen Zweck hin konzipierte künstliche neuronale Netzwerke (KNNs) auf Statistiken, Wahrscheinlichkeiten und Ähnlichkeiten basierende Texte. Je nach Trainingsdatensatz werden hier Large Language Models (LLMs) genutzt, und damit Sprachmodelle, die auf Basis einer teils unüberschaubar großen Menge unterschiedlicher, zumeist im Internet verfügbarer Texte trainiert wurden – im Falle des populären GPT3 sind das ca. 45 Terabyte an Daten mit ca. 175 Milliarden Parametern; inzwischen erscheinen wöchentlich größere Modelle unterschiedlicher Hersteller. Die Korpora, auf die sich Bajohr in Halbzeug stützt, sind dagegen zwar für eine:n menschliche:n Leser:in teils ebenfalls ›groß‹, aber letztlich endlich, überschaubar und vorausgewählt: Den Gedichten liegen konkrete und zumeist identifizierbare Einzeltexte zugrunde, die Menge aller Volltexte sollte sich im niedrigen Megabyte-Bereich bewegen.
Die Provenienz und Auswahl des Textmaterials sind nicht unbedeutend. Das Ergebnis, aber auch das Transformationskonzept und das Ursprungsmaterial stehen bei Bajohr in einem produktiven Spannungsverhältnis zueinander: Alle drei Ebenen formen erst zusammen die ›Botschaft‹ der konzeptuellen Texte; das Wissen um die Kopräsenz der Originale in der Appropriation ist somit von zentraler Bedeutung. Ebenso heben derartige konzeptuelle Korpustexte je nach Zusammenstellung und Anordnung Tendenzen und Widersprüche im Quellenkorpus hervor.20
Die zugrundeliegenden Prätexte werden anhand von Regeln, die der Autor (des Codes) festlegt, mithilfe digitaler Techniken transformiert. Halbzeug ist in vier Sektionen gegliedert, die Gedichte unterschiedlicher Transformationsmechanismen versammeln. Trotz allen ›progressiven‹ Technikeinsatzes lassen sich Bajohrs Gedichte – je nach Textmaterial und Mechanismus – in geradezu ›klassischen‹ Traditionen der experimentellen, automatischen, generativen Literatur- und Lyrikproduktion verorten: So werden in der Sektion automatengedichte beispielsweise an Stracheys Love Letters (1952) oder Enzensbergers Poesieautomaten (2000) angelehnt regelbasierte Texte generiert; in maschinensprache nutzt Bajohr ›glitches‹, also Übertragungs- und Konvertierungsfehler. Die Texte aus in corpore wiederum appropriieren kanonische (und gemeinfreie, frei verfügbare) Werke oder bewegen sich im »schon bestens etablierten Bereich der Appropriation, der sich vor allem an der Überführung nichtliterarischer bzw. nichtkünstlerischer Texte und Bücher in den Bereich der Literatur und Kunst interessiert zeigt, wie man es etwa von den ›Readymades‹ in der Found Poetry kennt«.21 In den appropriierenden Schreibweisen von Halbzeug finden sich weiterhin Anklänge an hermetische Lyrik, Automatengedichte, cut up, aleatorische Literatur, Oulipeme oder andere Schreibweisen aus dem Umfeld der Werkstatt für potenzielle Literatur. Diese beziehen den Menschen als Schöpfer des Transformationskonzeptes als elementaren Teil in den eigentlichen Textgeneseprozess ein, nicht aber als direkten Schöpfer des manifesten Textes.22 In Halbzeug setzt sich somit auch eine literaturgeschichtliche Entwicklung zur Appropriation fort, die »sich in den 1960-80er Jahren im Werk solcher Pioniere wie Carl Fredrik Reuterswärd, Marcel Broodthaers, Gerhard Rühm, Dieter Roth und Rodney Graham«23 angekündigt hat; »in den letzten zwei Dekaden hat sie an Geschwindigkeit und Verbreitung gewonnen und eine Fülle an Büchern hervorgebracht, die nicht mehr als singuläre Erscheinungen abgetan werden können.«24 Diese Entwicklung zum ›uncreative‹ oder ›conceptual writing‹25 hat sich durch »einen neuartigen Zugang zu Texten und zur Textualität als auch einen neuen Umgang mit geistigem Eigentum«26 ebenso beschleunigt wie durch die zunehmende Verbreitung digitaler Werkzeuge zur Texterzeugung und -verfremdung. Bei Bajohr potenziert sich zudem die ohnehin schon starke Hermetisierung lyrischer Sprache in der Großgattung, die gemeinhin als die sprachlich artifiziellste betrachtet werden kann, mithilfe digitaler, aber dennoch in der Geschichte der analogen Appropriationsliteratur verhaftete Verfahren: »Was früher trotz aller Postulate doch immer das Knistern des Dings brauchte, ist im Unding [des Digitalen] flüssige Wirklichkeit geworden. […] Auch Aleatorik, Kombinatorik und Iteration, die Lieblinge der alten Avantgarde, sind erst im Digitalen wirklich frei« (HZ, S. 102–103). Auch hier manifestiert sich somit das produktive Spannungsfeld zwischen Tradition und Innovation: Die Texte in Halbzeug schließen – trotz aller Digitalität – explizit an bereits etablierte Produktionsprozesse und Schreibweisen an.27 Der Textoutput ist zwar a priori ein Stück weit beeinflussbar und planbar, sowohl die große Menge des zugrundeliegenden Textmaterials als auch der jeweils zwischengeschaltete Prozess machen die genaue Gestalt des fertigen Gedichts jedoch nicht direkt absehbar, die Ergebnisse des maschinellen ›Schreibprozesses‹ können unerwartet sein. Hierdurch potenziert Bajohr die Verfahren klassischer Transformations- und Appropriationsliteratur und emanzipiert die manifesten Texte weiter von menschlicher Autorschaft.28 Das Textmaterial wird somit zu ›Halbzeug‹, zu unverarbeitetem Rohmaterial, wie Bajohr selbst hervorhebt: »Wo alles Text ist, gibt es kein Werk mehr, nur noch Halbzeug. Das Digitale ist […] die Sammlung von Instrumenten zu seiner eigenen Verarbeitung« (HZ, S. 102, Hervorh. i. Orig.). Die Titelmetapher ›Halbzeug‹ aus dem Vokabular der Fertigungstechnik markiert wiederum ostentativ wie performativ den zentralen Unterschied zu ›traditionellen‹ Formen von readymade oder aleatorischer Literatur: Anders als etwa bei Oulipo, Rühm oder Handke wird das Rohmaterial hier eben von der ›Maschine‹ verarbeitet, während der Mensch zum Bediener und Rohstofflieferanten wird.
II.1. Beispiel: Was man musss (Managementkorpus)
Ein Beispiel für dieses gleichermaßen deutbare wie mehrdeutige Zusammenspiel von appropriiertem Textmaterial, angewandtem Transformationskonzept und fertigem Transform findet sich im Gedicht Was man muss (Managementkorpus) (HZ, S. 12–14). Es stammt aus der ersten Sektion in corpore, die Gedichte enthält, die auf der Selektion und Transformation großer Textkorpora und dem »Suchen und Konstruieren von (visuell-auditiv-semantischen) Mustern« (HZ, S. 105) basieren.
Ursprung des Textmaterials ist in diesem Falle – wie auch die eingeklammerte Angabe im Titel hervorhebt – ein Korpus von acht Management- bzw. Karriereratgebern. Bajohr sortiert für das Gedicht Sätze, die mit »Sie müssen« beginnen, aufsteigend nach ihrer Länge (vgl. HZ, S. 14). Das Ergebnis ist ein gleichermaßen zynisch-kritisches wie literaturtheoretisch interessantes Gedicht (vgl. Abb. 1):

Dergestalt geordnet, steigert sich die Menge der Karriereimperative auch materiell, typographisch und damit performativ in einen anaphorischen Anforderungsberg, der sich nach mehrfachem umblättern nur weiter vergrößert und der die Leser:innen des Gedichts ebenso bedrängt und bedrückt wie die ursprünglichen Adressat:innen der zugrundeliegenden Ratgeber.29
Zudem erscheinen diese – aus ihrem ursprünglichen Kontext unterschiedlicher Ratgeber losgelösten – Ratschläge unverständlich, teils widersprüchlich oder sogar schon für sich genommen absurd: Die Gesamtmenge der Ratschläge verlangt von den Leser:innen mühelos harte Arbeit, Obrigkeitshörigkeit, Bescheidenheit, Misstrauen, Selbstverleugnung und die Aufgabe der Individualität und der eigenen Werte bei gleichzeitiger physischer und psychischer Hochleistungsfähigkeit, sie fordern ein Nebeneinander von Anspruch, Kreativität und dem Verzicht auf beides. Die kurzen und damit früh gegebenen Hinweise »Sie müssen es nur wollen« und »Sie müssen nur originell sein« (HZ, S. 12) sind bereits für sich genommen naiv – ad absurdum geführt werden sie, wenn diese zwei Hinweise sich durch das ›nur‹ als absolut und ausreichend ausweisen, aber als zwei von vielen in gerade diesem ›Hinweisberg‹ erscheinen. Die Frage »Sie müssen vor Ihrem Vortrag immer auf die Toilette?« (HZ, S. 12) dagegen scheint in diesem Kontext geradezu verächtlich über eins der häufigsten Stresssymptome zu spötteln. Sätze wie »Sie müssen auch Ihr Dasein vor sich selbst nicht begründen, geschweige denn rechtfertigen« (HZ, S. 13) geben dem Gedicht einen nihilistischen Ton, der mit Blick auf die Quellentexte nicht unangemessen erscheint – gleiches gilt für »Sie müssen sich von dem Stapel der anderen Lebensläufe abheben – oder das Spiel ist gelaufen« (HZ, S. 13) oder den letzten Satz des Gedichts: »Sie müssen Ihr Leben, alles, was Sie bisher getan haben, Ihre kompletten Pläne und Ziele ändern – oder Sie werden sterben« (HZ, S. 14). Das Gedicht als Summe von Prätextmaterial und digitalem Transformationskonzept stellt somit die Unerfüllbarkeit und Sinnlosigkeit von Karriereratschlägen und ihrer Vermarktung in Ratgeberform aus. Gedichte wie dieses markieren aber ebenso die Kontextabhängigkeit und Mehrdeutigkeit sprachlicher Zeichen: Was in seinem ursprünglichen Kontext im ›Sachbuch‹ ein möglicherweise sinnvoller, nüchterner Ratschlag ist, wirkt in Gedichtform rekontextualisiert einerseits selbst poetisch, andererseits geradezu komisch.
II.2. Beispiel: Schweigen
Das Gedicht Schweigen (HZ, S. 83) nutzt wiederum gänzlich andere Möglichkeiten des Digitalen zur Lyrikproduktion: Es entstammt der Sektion maschinensprache; hier nutzt Bajohr z. B. text-to-speech und speech-to-text oder auch Transkodierungsprozesse von einem Dateiformat in ein anderes.30 Erneut ist das Kreativ- und Bedeutungspotenzial der Ebene des Konzeptes und Prozesses eingeschrieben: Im Umwandlungsprozess entstehende ›Missverständnisse‹, Unschärfen, glitches oder schlicht Unmöglichkeiten fungieren als vermeintliche »Quelle plötzlichen Sinns« (HZ , S. 105).
Das Gedicht greift bereits auf den ersten Blick unverkennbar Eugen Gomringers gleichnamiges konkretes Gedicht Schweigen (1969) auf (vgl. Abb. 2 und 3).
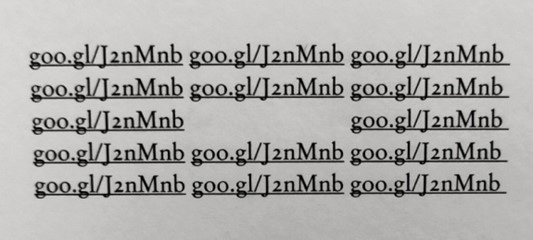

Gomringers Original illustriert, was ›Schweigen‹ letztlich ist: die Abwesenheit von Sprache. Auch dieser Text spielt also mit der Ambivalenz und Kontextgebundenheit von Sprache. Der Begriff ›Schweigen‹ ist schließlich paradox: Er repräsentiert das Konzept ›Schweigen‹, ist ausgesprochen – und damit als akustisches Signal wiedergegeben – selbst aber ein Geräusch. Auch als gedrucktes Wort ist ›Schweigen‹ ebenfalls anwesende, eben nicht abwesende Information, das eigentliche Schweigen findet sich bei Gomringer nicht im Wort ›Schweigen‹, sondern in der Leerstelle zwischen den Worten, in der eben nichts steht. Sprache kann Schweigen, die Abwesenheit von Sprache, nie wirklich wieder geben, ist nur eine ›Transkodierung‹ eines Konzeptes, eine Brücke zur Realität.Gleichzeitig braucht das Schweigen aber seinen Gegenpart, das ›Geräusch‹: der Vergleich zwischen Geräusch und Schweigen bringt beide Konzepte überhaupt erst hervor; ohne vorheriges Sprechen kann nicht geschwiegen werden; auch die Leerstelle in Gomringers Gedicht wäre ohne die um sie herum stehenden Worte nicht als solche erkennbar. Die Kopräsenz beider Texte und die ähnliche typographische Ausgestaltung lädt ebenso zu einem Vergleich zwischen Prätext und Transform ein. Bajohr erweitert schließlich diese sprachliche Paradoxie und die Transkodierung von Informationen in Töne mithilfe zweckentfremdeter digitaler Verfahren: Er öffnet eine Bilddatei und eine Worddatei zu Gomringers Original im Audioeditor Audacity – und damit als Audiodatei. Der daraus resultierende Datenstrom lässt sich unter der angegebenen – und in Anlehnung an die Textvorlage angeordneten – URL anhören. Was nun hier ertönt, ist definitiv kein Schweigen, auch nicht beispielsweise die Aufzeichnung einer Lesung des Gedichts. Hörbar werden stattdessen transkodierte Daten, die vor dieser Umwandlung Repräsentationen von Gomringers Gedicht waren, jetzt aber als für den Menschen nicht interpretierbares Geräusch sind.31 Auch das ist ›Schweigen‹ – oder sogar ambivalenterweise: Schweigen und Geräusch zugleich.
Das entstandene ›Geräusch‹ lässt sich zudem an die Deutung von Gomringers Original anbinden: Der Computer kennt in letzter Instanz nur Binarität: 0 und 1, ›an‹ und ›aus‹, Aktivierung und Nicht-Aktivierung, Stille und Signal, oder: Schweigen und Sprechen. Doch menschenverständliches ›Schweigen‹, noch dazu durch Gomringer in Lyrikform in einer von unendlich vielen möglichen Varianten thematisiert und vertextlicht, ist eine komplexe Information – eine Information zudem, die sich im Falle von Gomringers Schweigen inhaltlich, sprachlich sowie typographisch und räumlich manifestiert und damit letztlich auf unterschiedliche Weise interpretierbar ist.32 Hierdurch wird dem Gedicht eine weitere Ebene der Mehrdeutigkeit eingeschrieben. Bajohrs Transformation markiert so auch den Unterschied zwischen menschlichem Schweigen als Praktik mit Konsequenz und maschineller Nicht-Aktivierung. Reduziert man jedoch diese lyrische Repräsentation von Schweigen und die poetische Reflexion über ›Schweigen‹ auf 0 und 1, ergibt sich ironischerweise wieder nur menschenunverständliches Geräusch. Auch Menschen- und Maschinensprache brauchen schließlich Brücken in Form von Interpretern und Codecs.
Zudem erweitert Bajohr Gomringers Gedicht um eine intermediale Ebene und spielt mit den Beschränkungen des ›klassischen‹, materialen Buchs: Tinte und Papier sind monomedial und still; erst das Abtippen des Links und das Herunterladen der Audiodatei machen das ›Gedicht‹ hörbar. Zudem hebt Bajohr hier die mehrdeutige Digitalität von Halbzeug hervor: Viele Gedichte in diesem Band unterscheiden sich in ihrer Veröffentlichung in gedruckter, ›analoger‹ Buchform zunächst kaum von ihren traditionellen Vorläufern; lediglich der paratextuell hervorgehobene Produktionsprozess stützt sich auf das Digitale. Im Falle von Schweigen rückt der digitale Raum aber über die Verwendung von Audiodateien und bearbeitungsprogrammen sowie Hyperlinks überdeutlich in den Fokus und wird so auch für die Rezeption und Deutung zentral. Gewissermaßen handelt es sich bei diesem Schweigen somit um ein ›Hybridgedicht‹, das zwischen den unterschiedlichen Spielarten analoger und digitaler Literatur steht: Die materiale Textliteratur erweitert sich zur computernutzbaren, der gedruckte Text wird zur Weiterleitung – zum Link – auf das Digitale.
III. Fazit: Viele Fragen, mehrdeutige Antworten
Nun ist Halbzeug ein Werk von vielen im inzwischen weiter gewachsenen Œuvre von Hannes Bajohr und ein Beispiel von vielen in der stetig an Umfang zunehmenden Subgattung ›digitaler Literatur‹. Bereits die zwei hier behandelten Beispiele zeigen: Texte wie Halbzeug stellen Fragen, die sich die Literaturwissenschaft angesichts der zunehmenden Digitalisierung nicht nur des Literaturmarkts, sondern auch der Literaturproduktion stellen muss – und das auf einer handfesten, weitaus konkreteren Ebene, lange, bevor Tools wie ChatGPT o. ä. ins Spiel kommen. Diese Fragen und ihre möglichen Antworten sind ebenso vielfältig – mehrdeutig – wie die Ebenen von ›Literatur‹, die sie betreffen.
Die Frage nach dem Status des Kunstwerks wurde bereits angerissen: Kunst und Literatur befinden sich – frei nach Benjamin – im Zeitalter ihrer digitalen Produzierbarkeit. Auch hier kommt ein Moment der Mehrdeutigkeit zum Tragen, wenn hinter all diesen Transformationsprozessen die Frage aufgeworfen wird, was das eigentliche ›Kunstwerk‹ ist. Zum Beispiel bei Bajohrs Schweigen: Ist es Gomringers Original? Schließlich bekommen die Leser:innen hier letztlich Gomringers Gedicht – wenngleich für Menschen zunächst unverständlich transkodiert – präsentiert. Oder ist es Bajohrs ›Gedicht‹ aus arrangierten Links? Oder ist es die Datei hinter dem Link? Oder liegt der kreative Akt und das eigentliche ›Werk‹ auf der Ebene von Selektion, Konzeption und Code? Die Konzeptkunst formuliert diese Frage, wo der Akt des Kunstschaffens, wo das Kunstwerk verortet ist, von jeher. Umso deutlicher wird sie auch bei digital erzeugter Literatur gestellt, die nicht nur auf der Ebene der Performanz und konkreten medialen Manifestation analysiert werden kann:
Vielmehr geraten (auch) der Quellcode, der Datenverarbeitungsprozess, der Code-Schreibprozess, der technische Kontext und deren historische Dimension in den Blick. Jedem Werk der digitalen Literatur sind eine mehrschichtige individuelle, literarische, mediale und technische Geschichte und ein multimodales Bezugssystem eingeschrieben, welche digital-literaturgeschichtliche Bezüge und Kontexte, mediengeschichtliche Aspekte der Bildschirmperformanz und Aspekte historischer digitaler Materialität (historische Aspekte des Quellcode, Programmiersprachen und -Umgebungen, Betriebssysteme und digitalforensische Befunde) umfassen können.33
Zusätzlich stellen digitale Konzepttexte wie die in Halbzeug nicht nur das Verständnis von Lyrik, sondern auch das klassische Konzept des ›Autors‹ als finale kreative, ›genialische‹ Instanz in Frage: Der ›Schriftsteller‹ als Textproduzent verstanden ist hier der Computer – doch, so Bajohr noch 2018, »Maschinen […] können nicht ›kreativ‹ sein«.34 Die menschliche, ›kreative‹ Autorschaft betrifft somit zunächst die Ebene des Codes und des Konzeptes, die einen vorher möglicherweise unvorhergesehenen Text hervorbringen.35 Der eigentliche kreative Prozess wird so geradezu antigenialisch zu einem Set von Regeln, die den eigentlichen ›Inhalt‹, das Erzählte und Verhandelte, nicht unbedingt als überhaupt relevant berücksichtigen müssen. Dies wiederum ist – überspitzt formuliert – klassischen Regelpoetiken und ihrem Anspruch auf ›Wohlgeformtheit‹ letztlich gar nicht so unähnlich: ob die Verse nun dem Trochäus oder 140 Twitter-Zeichen unterworfen sind, ob dem Text ein griechischer Mythos oder das deutsche Referenzkorpus zugrunde liegt, ob Retardation nach tragischem Moment oder langer Satz nach kürzerem Satz folgt, wird a priori durch Regeln festgelegt. Und ob nun Poet:innen oder Python-Skripte den finalen Text anhand dieses Bauplans generieren, erscheint aus dieser Perspektive betrachtet fast nebensächlich.
Zudem basieren diese Texte auf Werken vorheriger Autor:innen, deren Identifizierbarkeit und Deutungsansätze elementarer Teil des Konzeptes sind. Im Grunde genommen formuliert digitale Konzept- und Korpuslyrik wie die in Halbzeug eine progressiv von menschlicher Agency losgelöste Radikalisierung von Kristevas vielzitierten Reflexionen über Intertextualität:
Die drei Dimensionen [des textuellen Raumes] sind: das Subjekt der Schreibweise, der Adressat und die anderen Texte. (Diese drei Elemente stehen miteinander in einem Dialog.) Der Wortstatus läßt sich also folgendermaßen definieren: a) horizontal: das Wort im Text gehört zugleich dem Subjekt der Schreibweise und dem Adressat, und b) vertikal: das Wort im Text orientiert sich an dem vorangegangenen oder synchronen literarischen Korpus. […] [J]eder Text baut sich als Mosaik von Zitaten auf, jeder Text ist Absorption und Transformation eines anderen Textes. An die Stelle des Begriffs der Intersubjektivität tritt der Begriff der Intertextualität, und die poetische Sprache läßt sich zumindest als eine doppelte lesen.36
Dies betrifft digitale Korpusgedichte wie die Bajohrs ebenso wie ›Werke‹ von textgenerierenden, auf Large Language Models aufbauenden KI-Programmen: Die freie Verfügbarkeit unüberschaubar großer Mengen von Text im Allgemeinen und Literatur im Speziellen ermöglicht eine darauf aufbauende Produktion – und damit, Kristeva folgend, zunehmend hochauflösendere ›Mosaike‹ unüberschaubarer Intertextualität.
Hierdurch verschwimmt auch der Werkstatus des zugrundeliegenden Textmaterials sowie der Werkbegriff selbst: Das eigentliche, klar umgrenzte literarische ›Werk‹ wird in dem Moment, in dem es im Internet und/oder als maschinenlesbarer Text erscheint, automatisch zu weiterzuverarbeitendem Textmaterial, zu ›Halbzeug‹ eben, auf dem aufbauend andere Texte entstehen können – ohne dass dies von den primären Autor:innen kontrollier- oder überhaupt nachvollziehbar sein kann und ohne dass es auch den appropriierenden, ›sekundären‹ Autor:innen bekannt sein muss. Die Provenienz der Tessera in Kristevas ›Mosaik‹ wird zur teils nicht mehr nachvollziehbaren Nebensache.
Die fortschreitende Diffusion des ohnehin ambivalenten Status von Kunstwerk und Autor:innen spielt zudem mit herkömmlichen Lektürehaltungen. ›Pareidolie‹ bezeichnet den Hang des Menschen, in zufälligen Formen – Wolken, Gesteinsformationen – Gesichter und Bilder zu erkennen. Auch Leser:innen sind, trotz aller Negation von Autor:innenintention in der Wissenschaft, auf Sinnsuche in per se mehrdeutigen Kunstwerken konditioniert. Dies wird in regel- und maschinengenerierten Texten unterwandert: Leser:innen suchen, eben genau daran gewöhnt, in einem Akt lesender Pareidolie eine Aussage in den Texten an sich, die nicht nur mehrsinnig, sondern zunächst sinnlos sind, da sie von intentionslosen Programmen ausgegeben wurden. Erst über den ›Umweg‹ des Konzeptes wird der ›Sinn‹ oder die vermeintliche ›Bedeutung‹ erfahrbar, wird die Produktion – nicht bloß das Produkt – zum eigentlichen Botschaftsträger.
Auch diese weite Autorschafts-, Werk- und Sinnkonzeption wird von Texten wie denen in Halbzeug noch weiter subvertiert, ist doch die Identifizierbarkeit und Nachvollziehbarkeit des Produktionsprozesses Teil des Konzeptes. Nicht nur das zugrundeliegende Textmaterial ist zumeist gemeinfrei oder anderweitig offen im Internet verfügbar. Auch die verwendeten (Schreib-)Werkzeuge und der Transformationsprozess sind hier ›open source‹: am Ende der jeweiligen Gedichte sind, wenn schon kein konkreter Code, so doch Erläuterungen mitgegeben, die die Textgrundlage und den zugrundeliegenden Transformationsprozess inklusive verwendeter Programme erläutern. Alexander Waszynski folgend ist eine derartige »anteilige oder vollständige Offenlegung der technischen Verfahrensweise« ein Gattungsmerkmal digitaler Korpuspoesie, das an der weiteren Dekonstruktion herkömmlicher Autorschafts- und Werkkonzepte partizipiert:
»The instructions themselves are the work of art«, diese von Nick Montfort ausgegebene Direktive […] lässt sich […] auch als Teil eines verschachtelten ästhetischen Spiels betrachten. So tragen Hinweise auf die schwierige Lesbarkeit eines Gedichts zur Verkomplizierung dieser Lesbarkeit bei. Auch die Offenlegung von Herstellungsschritten mehrt die Erläuterungsbedürftigkeit eher als sie abzubauen, denn dadurch wird die Frage aufgeworfen, welche Funktion dieser Akt selbst einnimmt. Die von Autor*innen gegebenen Hinweise fallen auf den fruchtbaren Boden mediensensibler Wissenschaften, die es gewohnt sind, auf die Bedingtheiten ästhetischer Produkte zu achten. Digitale Literatur implementiert diesen Reflex als Teil einer neuen Strategie, die eine ›enge Symbiose‹ zwischen Theoriebildung und ästhetischen Gegenständen sucht. \ Solche Paratexte im weitesten Sinn sind entweder Teil der Veröffentlichung, als Einleitung oder Leseanweisung, oder sie geben, das Prinzip Konzeptliteratur ausreizend, in gesonderten Publikationen Hintergründe und Intentionen preis, sogar zum Beifügen von ›Herstellungsregeln‹.37
Diese ›Herstellungsregeln‹ sind auf einer ersten Ebene nicht als Teil des Gedichts, sondern als Peritexte lesbar, die zunächst »beschreiben, einordnen und reflektieren«.38 Diese Anleitungen oder andere Peri- und Epitexte wie Bajohrs Band Schreibenlassen (2022) dienen der Reflexion über Theorie und Praxis digitaler Literatur, die verwendeten Methoden, den eigenen Text, seine Produktionsprozesse und seinen Status im literarischen System. Hierin verbirgt sich zudem einerseits eine Authentifizierungsstrategie:
Es macht einen Unterschied, ob etwas überhaupt als Produkt digitaler Poesie deklariert wird. Die Deklaration ist ein rhetorischer Akt. Deswegen bleibt es möglich, bloß vorzugeben, es handle sich um einen genuin digital erstellten Text. Absolute Authentizität erreicht ein genuin digital erstellter Text erst mit seiner Nachprogrammierbarkeit und Offenlegung der Datengrundlage. Transparenz ist also auch eine literarische Strategie, die in ästhetischer Hinsicht derzeit sehr fruchtbare Differenz zwischen digital und nicht-digital aufrechtzuerhalten. Daraus ergibt sich eine strukturelle Nähe digitaler Poesie zum wissenschaftlichen Arbeiten. Auch in der Forschung sind Daten und Verfahrensschritte offenzulegen, um Ergebnisse überprüfbar zu machen.39
Diese Transparenz hat jedoch andererseits noch eine weitere Konsequenz: Gerade unter den Vorzeichen der Quelloffenheit und ›Antigenialität‹ gelesen, fungieren diese Erläuterungen schließlich auch als Anleitungen, Einladungen, die die Leser:innen zur Nachahmung und damit zu neuer Textproduktion anregen können. Damit wird nicht unbedingt zum Fortschreiben eines konkreten Textes oder Sujets aufgerufen. Die Leser:innen werden stattdessen durch diese Anleitungen auch zur Verwendung, Weiterentwicklung oder Neuschaffung von Prozessen und Konzepten inspiriert und ermächtigt, die inhaltlich wiederum beliebig gefüllt werden können. Was sich hier also (auch) konstituiert, ist eine (Quell-)Offenheit der Kunst, die konventionelle Konzepte von Künstlerschaft weiter aufweicht. Frei nach Beuys: Jeder Mensch ist ein:e Autor:in, solange er:sie das entsprechende Schreib(-werk)-zeug besitzt und beherrscht – ob das nun Füller, Schreibmaschinen, Code-Editoren, Konkordanzprogramme oder auch Audiobearbeitungsprogramme sind. Gleichzeitig ist hier aber auch kein Mensch Autor:in – schließlich wird das finale literarische ›Kunstwerk‹ vom Computer generiert, der kreative menschliche Anteil liegt vorrangig im Konzipieren des Konzeptes. Autor:innen digitaler Literatur geben ihre vermeintliche Autorität über das Kunstschaffen somit auch performativ auf und heben den digitalen Prozess und das Konzept in den Vordergrund. Zum Abschluss sollen daher zwei Sätze, die Bajohr in Was man muss provokativ-metafiktional zugespitzt aus den Karriererratgebern übernimmt, zitiert werden – schließlich sind diese aus Perspektive dieses Aufsatzes betrachtet und damit erneut reappropriiert, letzten Endes wie eine provokative Absage an die Kompetenzen konventioneller Autorschaft bei gleichzeitiger Einladung zu neuer, kreativer Textproduktion lesbar: »Sie müssen kein Sprachkünstler sein, um kräftige sprachliche Bilder zu erzeugen. […] Sie müssen nicht auf guten Stil, Grammatik, Zeichensetzung, Satzbau und vollständige Sätze achten« (HZ, S. 13).
- 1. Thorsten Ries: »Digitale Literatur als Gegenstand der Literaturwissenschaft. Ein multimodales Forschungsprogramm«. In: Hannes Bajohr/ Annette Gilbert (Hg.): TEXT + KRITIK Sonderband X/21: Digitale Literatur II (2021), S. 24–34, hier S. 24. Als Ausnahmen nennt Ries hier »vereinzelte[] historische[] und medienwissenschaftliche[] Beiträge« (ebd., S. 24) sowie die »Studien Hannes Bajohrs, Friedrich W. Blocks, Florian Cramers, Chris T. Funkhousers, Peter Gendollas, Saskia Reithers und Roberto Simanowskis« (ebd.).
- 2. Ries: Digitale Literatur als Gegenstand der Literaturwissenschaft, S. 31.
- 3. Auch daten- und computergestützte Zugriffe der digitalen Korpusliteraturwissenschaft, Computational Literary Studies, allgemeiner Digital Humanities und letztlich Informatik haben zunehmend Einzug in den literaturwissenschaftlichen Mainstream gehalten. Vgl. zur Diskussion und Umriss digitaler korpusbasierter Literaturwissenschaft u. a. J. Berenike Herrmann u. Gerhard Lauer: »Korpusliteraturwissenschaft. Zur Konzeption und Praxis am Beispiel eines Korpus zur literarischen Moderne«. In: Osnabrücker Beiträge zur Sprachtheorie 92 (2018), S. 127–156 sowie J. Berenike Herrmann u. a.: »Tool criticism in practice. On methods, tools and aims of computational literary studies«. In: Digital Humanities Quarterly, Special Issue on Tools Criticism 17.2 (2023). Diese Entwicklung lässt sich auch, wenngleich grob, so doch zum Thema passend textstatistisch nachweisen: Im Gesamtprogramm des Germanistentages 2022 findet sich der Begriff ›hermeneut*‹ beispielsweise 37 Mal. Der Suchbegriff ›gegenwart*‹ verzeichnet 45 Treffer, ›mittelalter*‹ dagegen 60, ›diskurs*‹ immerhin 84 – ›digital*‹ jedoch ist 85 Mal zu finden. Daraus allein lässt sich natürlich weder Dominanz noch Relevanz des Digitalen im literaturwissenschaftlichen Diskurs ableiten – eine interessante Tendenz lässt sich jedoch feststellen. Nicht uninteressant wäre in diesem Zusammenhang auch eine Metastudie, die die Programme literaturwissenschaftlicher Kongresse hinsichtlich der dort vertretenen Unterdisziplinen, Themen und Tendenzen z. B. diachron auswertet.
- 4. Vgl. u. a. Hannes Bajohr: »Künstliche Intelligenz und digitale Literatur«. In: Hannes Bajohr/ Annette Gilbert (Hg.): TEXT + KRITIK Sonderband X/21: Digitale Literatur II. München 2021, S. 174–185 zur Diskussion der Theorie, Praxis und »irreführende[n] Bezeichnung« (ebd., S. 174) ›Künstliche Intelligenz‹.
- 5. In seiner Analyse von Montfort/Stricklands Sea and Spar Between und Parrishs Articulations kommt Alexander Waszynski zu dem Schluss, dass gerade digitale Literatur zusätzlich an einer Vermengung der Werkzeuge der Wissenschaft und den Praktiken der Kunst partizipieren, indem sie beides applizieren: »Der ästhetische Mehrwert entsteht nicht in Konkurrenz zum Anspruch auf Quantifizierbarkeit, sondern gewissermaßen als dessen Konsequenz. Digitale Poesie richtet sich, indem sie sie entwendet, gegen die bloße Anwendung von Methoden. Gleichzeitig soll etwas an Texten, an der Sprache und an Sprachen wahrnehmbar gemacht werden. Das akademische Beschreibungsinventar gerät in den Einzugsbereich der Kunst, was sich auch in der vordigitalen Literaturgeschichte, etwa in der Frühromantik, beobachten lässt« (Alexander Waszynski: »Reflexive Immersion. Zur Lesbarkeit korpusbasierter digitaler Poesie«. In: Hannes Bajohr/ Annette Gilbert (Hg.): TEXT + KRITIK Sonderband X/21: Digitale Literatur II. München 2021, S. 160–171, hier S. 168). Bereits im Zitat ist von »Digitale Poesie« im Allgemeinen die Rede, damit ergibt sich von selbst, dass sie sich auch auf andere digitale Literatur übertragen lassen soll.
- 6. Ries: Digitale Literatur als Gegenstand der Literaturwissenschaft, S. 25.
- 7. Vgl. Roberto Simanowski (Hg.): TEXT + KRITIK Sonderband X/0: Digitale Literatur. München 2001. Während zur Entstehungszeit des ersten Bandes der rudimentär internet- und multimediafähige Personal Computer gerade erst so recht in den Haushalten ankommt, ist das Smartphone zur Entstehungszeit des zweiten ubiquitär. Die zur Verfügung stehenden Rechen- und Speicherkapazitäten steigen ebenso exponentiell wie die täglich verarbeiteten und vor allem gesammelten Daten. Folglich verschiebt sich der Diskurs in diesen 20 Jahren mehrfach: vom endlich realisierbaren ›global village‹ (vgl. Marshall McLuhan: The Gutenberg Galaxy. The making of typographicman. Toronto 1962, S. 21), den optimistisch verklärten sozialen Potenzialen weltweiter Vernetzung oder den medialen, narrativen Möglichkeiten der Hypertextualität hin zu gefährdeter Privatheit durch verunmöglichten Datenschutz sowie zu den Potenzialen und Risiken marktreif gewordener ›künstlicher Intelligenz‹.
- 8. Vgl. Hannes Bajohr/ Annette Gilbert (Hg.): TEXT + KRITIK Sonderband X/21: Digitale Literatur II. München 2021.
- 9. Vgl. zu Halbzeug auch Robin M. Aust: »Das Schreiben unter digitalen Bedingungen«. Interview mit Hannes Bajohr über Halbzeug. In: Germanica 64 (2019): Lyrik des 21. Jahrhunderts, S. 201–211.
- 10. Annette Gilbert: »Zur Einführung«. In: Dies. (Hg.): Wiederaufgelegt. Zur Appropriation von Texten und Büchern in Büchern. Bielefeld 2012, S. 9–24, hier S. 13f.
- 11. Vgl. zur Diskussion, ob als Buch gedruckte digital erzeugte Literatur auch ›digitale Literatur‹ sei, oder ob dieser Begriff Literatur vorbehalten sein sollte, die die vielfältigen, dynamischen Möglichkeiten des Digitalen auch publikations- und rezeptionsseitig nutzt u. a. auch Ries: Digitale Literatur als Gegenstand der Literaturwissenschaft, S. 25f.
- 12. Vgl. hierzu u. a. Niels Penke: »Populäre Schreibweisen. Instapoetry und fan-fiction«. In: Hannes Bajohr/ Annette Gilbert (Hg.): TEXT + KRITIK Sonderband X/21: Digitale Literatur II. München 2021, S. 91–105 sowie Berit Glanz: »›Bin ich das Arschloch hier?‹ Wie reddit und Twitter neue literarische Schreibweisen hervorbringen«. In: Hannes Bajohr/ Annette Gilbert (Hg.): TEXT + KRITIK Sonderband X/21: Digitale Literatur II. München 2021, S. 106–117.
- 13. Ries: Digitale Literatur als Gegenstand der Literaturwissenschaft, S. 25. Ries zitiert hier Espen Aarseth: Cybertext. Perspectives on Ergodic Literature. Baltimore 1997, S. 1f.
- 14. Eine eBook-Variante von Halbzeug existiert zwar ebenso, – wie die Bezeichnung ›eBook‹ aber bereits andeutet, handelt es sich hierbei um die digitale Variante eines analogen Buchs; die potenzielle Dynamik, Multimedialität oder Hypertextualität digitaler Publikationsformen wird hier ebenfalls nicht genutzt; das Analoge wird im Digitalen abgebildet.
- 15. Hannes Bajohr: Schreibenlassen. Texte zur Literatur im Digitalen. Berlin 2022, S. 71.
- 16. Waszynski: Reflexive Immersion, S. 160.
- 17. Gilbert: Zur Einführung, S. 9. Die von Gilbert ebenfalls genannten Aspekte der Vollständigkeit und Materialität werden in Halbzeug nicht direkt relevant, zumal das Textmaterial hier als maschinenlesbarer, digitaler Text verfremdet und teils rekontextualisiert wird. Dennoch bewegen sich die Texte in konzeptueller Nähe zur Appropriation.
- 18. Alexander Waszynski analysiert mit Nick Montforts und Stephanie Stricklands Sea and Spar Between (2010/2020) und Allison Parrishs Articulations (2018) zwei ähnlich konzipierte, wenngleich dynamisch-interaktivere Werke (vgl. Waszynski: Reflexive Immersion).
- 19. Diese rücken zunehmend auch in den Fokus der Literaturwissenschaft rücken – ob nun positiv betrachtet, als Kreativtool für Autor:innen, oder negativ, als Möglichkeit für Student:innen, bei Hausarbeiten zu plagiieren.
- 20. Ähnlich verhält es sich auch mit KI-generierten Texten, die durch den verwendeten Trainingsdatensatz ein inhärentes Bias aufweisen können. Vgl. hierzu auch Abschnitt 6.2 des ursprünglichen GPT3-Papers von Thomas B. Brown u. a.: »Language Models are Few-Shot Learners«. In: Advances in Neural Information Processing Systems 33 (2020), online verfügbar unter https://papers.nips.cc/paper_files/paper/2020/hash/1457c0d6bfcb4967418bfb8ac142f64a-Abstract.html (zuletzt eingesehen am 17. März 2024).
- 21. Gilbert: Zur Einführung, S. 19. Vgl. hierzu weiterhin die Beiträge von Christoph Benjamin Schulz, Stefan Ripplinger und Anne Mœglin-Delcroix im genannten Band.
- 22. Vgl. für eine weitere zeitgenössische, aber analoge Spielart ›gefundener‹ Lyrik die Gedichtbände Dachbodenfund (2015), In der Isolierzelle (2017) sowie Solar Plexy (2018) von Nicolas Mahler, die jeweils Texte aus Spielzeugauktionskatalogen, Technikmagazinen resp. Erotikzeitschriften als Gedichte appropriieren; im Falle des ähnlichen Bandes Spam (2009) ist das Textmaterial wie der Titel ahnen lässt digitaler Provenienz. Vgl. hierzu auch RobinM. Aust: »Grenzfälle und das Fallen von Grenzen. Poetologische Reflexionen in Nicolas Mahlers Formexperimenten«. In: Christian Bachmann u. Sunghwa Kim (Hg.): Nicolas Mahler im Kontext. (= Closure, Kieler e-Journal für Comicforschung 5.5, Kiel 2019), online verfügbar unter https://www.closure.uni-kiel.de/closure5.5/aust (zuletzt eingesehen am 17. März 2024) sowie Robin M. Aust: Dachbodenfund(e). Melancholie und die Ästhetik des Gebrauchten bei Nicolas Mahler [2024, in Vorbereitung]. Auch Mahlers Literaturcomic Ulysses (2020) verwendet gefundene Zeitungsausschnitte als Text- bzw. Bildmaterial.
- 23. Gilbert: Zur Einführung, S. 13.
- 24. Ebd.
- 25. Vgl. hierzu auch Stefan Römer: Lektürepolitik zwischen Kunst, Aneignung und Literatur – Conceptual Writing«. In: Annette Gilbert (Hg.): Wiederaufgelegt. Zur Appropriation von Texten und Büchern in Büchern. Bielefeld 2012, S. 49–66, hier insbesondere S. 50–52.
- 26. Gilbert: Zur Einführung, S. 13.
- 27. Für einen Abriss zum gattungsgeschichtlichen Verhältnis von digitaler und ›analoger‹ Konzept- und Korpusliteratur vgl. auch Ries: Digitale Literatur als Gegenstand der Literaturwissenschaft, S. 28f.
- 28. Durch die schiere, unübersichtliche und auch anonyme Textmenge und auch den Bedienungsmodus von Text-KIs wird die bei intertextueller, appropriierter oder anderweitig transformierter Literatur ohnehin diffuse Konzept vermeintlicher Autorschaft zusätzlich fragil. Bajohr führt in Künstliche Intelligenz und digitale Literatur hierzu aus: »Der Bruch zwischen den Paradigmen berührt auch die Autorschaftsfrage, deren menschliche Seite im Mensch-Maschine-Gefüge eine zunehmende Distanzierung durchläuft: Konnte man im sequenziellen Paradigma noch plausibel von sekundärer Autorschaft sprechen, die in der Formulierung einer Regelfolge besteht, deren Ausführung das Werk produziert […], steht man bei KNNs vor einer tertiären Autorschaft: Es bleiben allein der Datensatz für das Training zu definieren, aus denen das KNN selbstständig das Modell bildet, und die Parameter zu bestimmen, mittels derer das Modell schließlich den Output hervorbringt. Bei großen Sprach-KIs wie GPT-3 ist selbst das nicht mehr möglich, denn das Training ist hier zu aufwändig, um es auf je neue Datensätze abzustimmen. Die ›Programmierung‹ erfolgt durch die normalsprachliche Formulierung von Aufforderungen (›prompt design‹) nach dem Vorbild dialogischer Kommunikation – hier wäre gar von quartärer Autorschaft zu sprechen« (Bajohr: Künstliche Intelligenz und digitale Literatur, S. 177f.). Vgl. ebenso Jasmin Meerhoff: »Verteilung und Zerstäubung. Zur Autorschaft computergestützter Literatur«. In Hannes Bajohr/ Annette Gilbert (Hg.): TEXT + KRITIK Sonderband X/21: Digitale Literatur II. München 2021, S. 174–185.
- 29. Interessanterweise erinnern die so arrangierten Sätze zudem optisch an die im Projektmanagement häufig verwendeten Gantt-Diagramme, in denen offene Aufgaben und Milestones eines Projektes verteilt und visualisiert werden, und die symbolisch gerade für die Manifestationen der ›hustle culture‹ stehen, die Bajohrs Gedicht kritisiert.
- 30. Vgl. zum detaillierten Prozess auch Bajohr: Schreibenlassen, S. 108–117.
- 31. Man denke hier auch an die zur Commodore-C64-Zeit weit verbreiteten Datasetten, Hotlines oder den ›Hard-Bit-Rock‹ im WDR Computerclub (vgl. zur Geschichte sonifizierter Programme, ihrer Einsatzmöglichkeiten und Spielarten den Beitrag von Höltgen, Stefan: »Hard-Bit Rock«. In: Retro. Computer – Spiele – Kultur 28 (2013), online verfügbar auf dessen Blog unter http://www.simulationsraum.de/blog/2016/01/08/hard-bit-rock/ (zuletzt eingesehen am 17. März 2024)). Wie bei einem derartigen Bitstream ließe sich dieses akustische Signal mit der entsprechenden Software und den entsprechenden Einstellungen auch wieder in die Originaldateien zurückkonvertieren.
- 32. So ist Gomringers Gedicht nicht nur als ›bloße‹ Reflexion über menschliches Schweigen lesbar, sondern deutet ebenfalls visuell auf die Abwesenheit von sprechenden Personen in der Mitte der Gesellschaft – der Stillschweigen bewahrenden ›großen Masse‹. Es wird aus dieser Perspektive betrachtet auch als Shoah-Gedicht lesbar. Ich danke Niels Penke herzlich für den Hinweis auf diese Lesart.
- 33. Ries: Digitale Literatur als Gegenstand der Literaturwissenschaft, S. 27. Ries bezieht sich hier auf interaktive, dynamische digitale Literatur, die im digitalen Raum rezipiert wird; seine Thesen haben aber auch für ›analoge‹, konventionell als Buch gedruckte und ›lediglich‹ digital generierte Literatur Gültigkeit.
- 34. Bajohr: Schreibenlassen, S. 35.
- 35. Vgl. ebd., S. 36f.
- 36. Julia Kristeva: »Bachtin, das Wort, der Dialog und der Roman«. In: Jens Ihwe (Hg.): Literaturwissenschaft und Linguistik. Ergebnisse und Perspektiven. Bd. 3: Zur linguistischen Basis der Literaturwissenschaft II. Frankfurt a. M. 1971, S. 345–375, hier S. 347f.
- 37. Waszynski: Reflexive Immersion, S. 160. Waszynski zitiert hier Arthur I. Miller: The Artist in the Machine. The World of AI-Powered Creativity. Cambridge/ London 2019, S. 214.
- 38. Waszynski: Reflexive Immersion, S. 161.
- 39. Ebd., S. 166f. Ein Band, der auf spielerische Weise über diesen ›Pakt‹ der Transparenz digitaler Literatur reflektiert, ist der von Fabian Navarro herausgegebene Band poesie.exe. Texte von Menschen und Maschinen, Berlin 2020, der konventionell und ›maschinell‹ erzeugte Texte gegenüberstellt und die Leser:innen zum Raten einlädt; die jeweiligen Autor:innen und Prozesse werden erst am Ende des Buches enthüllt.


