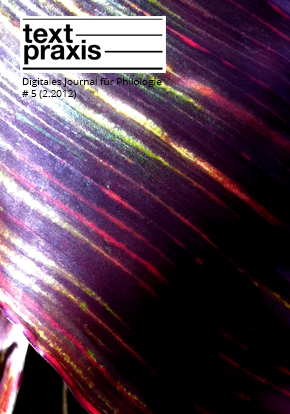Digitales Journal für Philologie
Überleben & Überschreiten vs. Überlesen & Überschreiben
Der Titel dieses Beitrags mag zunächst pathetisch und plakativ erscheinen. Vielleicht ist er das auch. Mehr jedoch ist er als großes Unbehagen gegenüber einer mittlerweile etablierten, heteronormativen Ein- und Zuordnung queerer Interventionsbestrebungen in der Literatur- und Kulturwissenschaft zu verstehen. Ein grundsätzliches, heteronormatives Geschlechts- und Sexualitätsverständnis darf nämlich – auch literarisch – scheinbar nicht infrage gestellt werden. Falls dies doch geschieht, wird durch Verweise auf die sexuell-geschlechtliche ›Andersartigkeit‹ des Autors oder der Autorin sichergestellt, dass sie individuell und exzeptionell zuschreibbar sind. Mit Hilfe weiterer Kontroll- und Einschränkungsinstanzen des Diskurses wie zum Beispiel dem Kommentar und der Disziplin werden sie zusätzlich gebändigt und so anti-queert. Sowohl im akademischen als auch populären Gebrauch wird ›queer‹ schon seit einiger Zeit nicht mehr abgrenzend zu den häufig analog gebrauchten Termini gay/lesbian oder homosexual verstanden. Die Tatsache des mittlerweile vorwiegend austauschbaren Gebrauchs dieser Begrifflichkeiten kann, ähnlich wie die Tendenz zu eindeutigen, kategorialen Lesarten der ausgewählten literarischen Texte, als wirksame Selbstaffirmation der heteronormativen Matrix verstanden werden, die dem subversiven Potenzial einer beständigen Infragestellung ihrer ›Natürlichkeit‹ entgegenwirkt. Mit Hilfe solcher diskursiven Regulierungsmechanismen wird zum einen die Lesbarkeit und Authentizität von Identitäten bekräftigt und zum anderen die Natürlichkeit und Normalität der heteronormativen Logik von Geschlecht und Sexualität aufrechterhalten. Die grundsätzliche Unnatürlichkeit beziehungsweise Performativität von Identitätskategorien wird durch den diskursiven Ordnungsapparat somit aberkannt und jede Seinsmöglichkeit jenseits binärer Strukturen verhindert. Judith Butler schreibt in Undoing Gender diesbezüglich von einer Gewalt, begründet in
a profound desire to keep the order of binary gender natural or necessary, to make of it a structure, either natural or cultural, or both, that no human can oppose, and still remain human. If a person [or text] opposes norms of binary gender […] and that stylized opposition is legible, then it seems that violence emerges precisely as the demand to undo that legibility, to question its possibility, to render it unreal and impossible in the face of its appearance to the contrary.1 [meine Ergänzung; D.S.]
Verdeutlichen lässt sich die Gewalt, die durch die Insistenz auf die heteronormative Ordnung hervorgerufen wird, an der mehrheitlichen Überschriebenheit des subversiven Potenzials queerer Diskursbeiträge. Beispielhaft hierfür liest sich die etablierte Rezeption und literarische Neuaneignung von zwei Romanklassikern der englischen Literaturgeschichte: Sowohl Oscar Wildes The Picture of Dorian Gray (1890/1891) als auch Virginia Woolfs Mrs. Dalloway (1925) inspirierten während der letzten Millenniumswende gleich vier Autoren dazu, die Erzählungen neu zu adaptieren, fortzusetzen oder ihnen eine neue, ›modernisierte‹ Gestalt zu geben. Michael Cunninghams The Hours (1999), Will Selfs Dorian. An Imitation (2002), Robin Lippincotts Mr. Dalloway (1999) und Jeremy Reeds Dorian. A Sequel (1998) bezeugen die ungebrochene Popularität und Aktualität der Romane von Wilde und Woolf und sind sicher auch als Hommagen an deren Erzählkunst zu verstehen. Gerade deshalb verblüffen die fragwürdigen Gestaltungsformen der Aneignung und Huldigung, die die Handlungsspielräume der Erzählungen eher einengen als weiterzuführen.2 Vor diesem Hintergrund wirken die ›Originale‹ deutlich subversiver und spielerischer als ihre selbsterklärten Nachkommen in ihrem Beharren auf Repräsentation, Essenz und Teleologie; eben jene ›Funktionen‹ von Literatur, die Wilde und Woolf nicht nur ablehnten, sondern in den beiden Romanen auch problematisiert werden.3
In separierter Form haben beide Erzählungen eine lange und anhaltende Rezeptionsgeschichte und einen gesicherten Platz im britischen Literaturkanon, doch wurden weder die Romane noch deren Autor_innen bislang in einen näheren, theoretischen oder/und literarischen Zusammenhang gebracht. Vielmehr werden Oscar Wilde und Virginia Woolf vor allem als Galionsfiguren verschiedener Epochen und Ästhetiken, dem viktorianisch-dekadenten Fin de Siècle einerseits und dem experimentell-feministischen Modernismus anderseits, wahrgenommen. Allerdings werden beide als Ikonen einer lesbisch-schwulen Literaturgeschichte lange vor ›Gay Liberation‹ in einen Bedeutungszusammenhang von homosexueller Repräsentanz und Identifikation gerückt, der vor allem durch biographische Rückbezüge nahegelegt wurde. Es ist jedoch genau diese Mythologisierung ihrer ›Homosexualität‹ und die gängige Annahme, sie schrieben aufgrund gesellschaftlich erzwungener Geheimhaltung in codierter Form über ihre gleichgeschlechtliche Liebe, die ihren literarischen Werken eine umfassendere Subversion von und weiter reichende Kritik an literarischen und gesellschaftlichen Konventionen versagt.
Dabei ist meiner Ansicht nach genau die Infragestellung und Denaturalisierung von normativen, textuellen und sexuellen Identitäten sowohl das Anliegen von The Picture of Dorian Gray als auch von Mrs. Dalloway. Wilde und Woolf lassen in ihren Texten bereits anti-essenzialistische Überlegungen und Strategien erkennen, wie sie später von Roland Barthes, Michel Foucault und Judith Butler reformuliert wurden und können somit als Vorfahren queerer Theorie und Politik verstanden werden. Doch die Mythologisierung, Klassifizierung und Kategorisierung beider Texte und ihrer Autor_innen, besonders in der fortlaufenden Heranziehung ihrer Biographien, hat den Blick für die gemeinsamen und radikalen Strategien der Unterminierung naturalisierter Signifikationen verstellt. So werden die Romane in der gängigen Wahrnehmung biographisch-selbstreferenziell verstanden,4 während beide Texte einen literarischen Realismus und damit die Möglichkeit authentischer Repräsentation vehement bestreiten. Um das umfassende, dekonstruktive Wirkungspotenzial von The Picture of Dorian Gray and Mrs. Dalloway herauszustellen, erweist sich die Kombination der Theorien von Barthes und Butler als äußerst nützlich. In ihren Überlegungen zur Performativität von Text (Barthes) und Sex (Butler) legen sie dar, wie jegliche Erfahrung und jeglicher ›Ausdruck‹ von ›Realität‹ immer schon durch Konventionen und Ordnungen geformt werden, und somit weder natürlich noch ›originär‹ sein können. Damit einhergehend ist auch die Artikulation von geschlechtlichem und sexuellem Empfinden symbolischen und performativen Bedingungen unterworfen. Um gesellschaftlich anerkannt und verstanden zu werden, bedarf es der Eindeutigkeit und der Wiederholung naturalisierter Konventionen, was wiederum eine Stilllegung individueller Seins- und Signifikationspotenziale bedeutet.
Genau diese radikalen, scheinbar poststrukturalistischen Überlegungen lassen sich in der literarischen Gestaltung von Wildes und Woolfs Romanen bereits feststellen, genauso wie ihre Widersetzung und Widersatzung gegen Vereinnahmung, Vereinheitlichung und Kategorisierung von Performanzen. Beide Romane artikulieren ein Wirklichkeitsverständnis, welches nicht auf eine wesenhafte Bedeutungsimmanenz sondern auf ihre naturalisierte Mythologisierung rekurriert. Wilde und Woolf verstehen Sprache und Welterfahrung als untrennbar miteinander verbunden und drücken ihre Besorgnis über konventionalisierte und essenzialisierte Wahrheitsverständnisse in vielen ihrer Schriften aus:
The first duty of life is to be as artificial as possible. What the second duty is no one has yet discovered. In all unimportant matters, style, not sincerity, is the essential. In all important matters, style, not sincerity, is the essential. If one tells the truth, one is sure, sooner or later, to be found out.5
Whether we call it life or spirit, truth or reality, this, the essential thing, has moved off, or on, and refuses to be contained any longer in such ill-fitting vestments as we provide.6
Obwohl der Ton, in dem Wilde und Woolf ihre Skepsis gegenüber ›wahren‹ und ›wesentlichen‹ Performanzen artikulieren, sicher unterschiedlich ist, lässt sich doch in beiden Formulierungen eine deutliche Absage an die gängigen Separierungen von Form und Inhalt, Kunst und Natur, Oberflächlichkeit und Essenz erkennen. Sowohl Wilde als auch Woolf setzen Form und Inhalt, Sprache und Wirklichkeit in einen nicht lösbaren Zusammenhang und ermahnen genau aus diesem Grund zu einem spielerischen, anti-essenziellen Lesen und Schreiben. Denn ein Lesen und Schreiben, das nach Essenzen und Wahrheiten sucht, wird notwendigerweise enttäuscht beziehungsweise schränkt die einem Text inhärenten Bedeutungsmöglichkeiten erheblich ein. Sprache konstruiert und bestimmt einerseits unser Realitätsverständnis, aber das arbiträre Verhältnis von Sprache und ›Wirklichkeit‹ negiert die Möglichkeit einer authentischen oder repräsentativen Ausdrucksform des Selbst. Allerdings kann die sprachlich-symbolische Ordnung von Identitäten in ihrer kategorialen, konventionellen und naturalisierten Form zu einer fatalen Daseinsbestimmung des Individuums führen, ein Thema, das sowohl in The Picture of Dorian Gray als auch Mrs. Dalloway leitmotivische Funktion erhält.
Bereits die Titel der Erzählungen verweisen auf die fatale Verflechtung der symbolischen Ordnung mit individuellen Lebensentwürfen. Es ist schließlich nur ein Bild von Dorian, das für ihn zum fatalen Bedeutungsträger wird, weil er damit an ein Image gebunden bleibt, das der Komplexität seines Ich-Empfindens nicht entspricht und somit zu einer sich kontinuierlich steigernden Selbstentfremdung führt. Die Titelheldin von Woolfs Roman wiederum verschwindet hinter dem Namen Mrs. Dalloway, der ihr von einer patriarchalen Gesellschaft zugewiesen wird. Auch Clarissa spürt die Anstrengung und Absurdität, anhaltend eine kohärente Identität verkörpern zu müssen, die ihrem ambivalenten Selbstempfinden allenfalls temporär entspricht oder entsprach:
That she held herself well was true; and had nice hands and feet; and dressed well, considering that she spent little. But often now this body she wore…this body, with all its capacities, seemed nothing – nothing at all. She had the oddest sense of being herself invisible, unseen; unknown; there being no more marrying, no more having of children now, but only this astonishing and rather solemn progress with the rest of them, up Bond Street, this being Mrs. Dalloway; not even Clarissa any more; this being Mrs. Richard Dalloway.7 (11)
Individuelle Komplexität wird durch kategoriale, soziale Identitäten überschrieben und sinnliche Wahrnehmungen können in der performativen Beschaffenheit der Sprache niemals authentisch beschrieben werden. Der Wunsch nach sozialer Anerkennung und der gleichzeitige Verlust von Identitätspotenzialen bringt daher zwangsläufig ein fortwährendes Spannungsverhältnis mit sich. Wie beide Romane deutlich machen, führt dies in dramatischster Konsequenz zur unerträglichen Selbstentfremdung und letztlich zum Selbstmord, wobei die Erzählungen die Frage aufwerfen, inwieweit die Figuren von ihrem sozialen Umfeld festgeschrieben und somit in den Suizid getrieben werden.
Sowohl The Picture of Dorian Gray als auch Mrs. Dalloway sind selbstreflexive Romane und verweisen immer wieder auf ein temporäres, fluides und komplexes Ich-Empfinden und die grundsätzliche Unmöglichkeit wahrer, natürlicher und allgemeingültiger Bedeutungsfindung. Personelle und textuelle Identitäten sind immer schon performativ, künstlich, un-eigen und sind daher zugleich Bedingung und Verhinderung interpersoneller Kommunikation. Beide Erzählungen schildern die vergebliche Suche nach einem übergeordneten, dauerhaften Sinn, nach Gültigkeit und Wahrheit in einer durch Konventionen und Normierungen strukturierten sozial-symbolischen Ordnung. Dieser Ordnung ist in der Logik beider Romane nur durch Skepsis und der Abkehr von ihren essenzialisierten Bedeutungszusammenhängen mit Hilfe von Sprachspielen, Paradoxien und alternativen Semiologien zu entkommen. Entgegen der gängigen Rezeption und Adaption, die nach Essenzen und Repräsentanz sucht, folgen die semiologischen Konzeptionen von The Picture of Dorian Gray und Mrs. Dalloway einer Vorstellung von Literatur, in der »writing constantly posits meaning, but always in order to evaporate it […] by refusing to assign to the text (and to the world as text) a ›secret,‹ i.e., an ultimate meaning.«8 Roland Barthes führt dies in The Death of the Author noch weiter aus:
Writing can no longer designate an operation of recording, notation, representation, or »depiction« (as the Classics would say); rather, it designates […] a performative, a rare verbal form (exclusively given in the first person and in the present tense) in which the enunciation has no other content (contains no other proposition) than the act by which it is uttered.9
Allerdings erscheint diese Logik und Ermahnung in der gängigen Rezeption von Wilde und Woolf kaum Berücksichtigung zu finden, im Gegenteil ist die Mythologisierung der Autor_in-Funktion bei ihren Werken überdurchschnittlich hoch. Obwohl sowohl Oscar Wilde als auch Virginia Woolf ihre Romane bewusst ambivalent und autor-los konzipieren, kein »Geheimnis« und keine »ultimative Bedeutung« bereitstellen, wird dies in den vorherrschenden Lesarten beider Erzählungen ignoriert und sehr häufig kontrahiert. In der Mehrheit lässt sich ein vorherrschendes Misstrauen gegenüber der ›Sperrigkeit‹ und Uneindeutigkeit der Texte feststellen, scheinbar nahegelegt durch die von Barthes ebenfalls problematisierte Annahme, dass »the Author is supposed to feed the book [and] has the same relation of antecedence with his work that a father [or mother] sustains with his child.«10 [meine Ergänzung; D.S.] Entgegen der Kritik von Wilde und Woolf an einengenden Kunst- und Literaturverständnissen durch biographische und repräsentative Lesarten, kann scheinbar kaum eine Romananalyse ihrer Texte auf biographische Rückbezüge verzichten. In ihrer Einleitung zu Woolfs Roman The Voyage Out postuliert Jane Wheare eine solche biographische Herangehensweise an die Texte der Schriftstellerin sogar als die einzig mögliche:
Many of the problems which we encounter in reading her more experimental fiction, however, evaporate if we recognize that, far from being interested simply in the form of her novels, Woolf was essentially an autobiographical writer. Interest in the details of an author’s life can be merely prurient or, at any rate, of little relevance to their work. In the case of Woolf, however, there is a legitimate inquiry to be made into her private life and opinions, and one which greatly enhances our understanding of her experimental fiction. Such obscurities as are to be found, for example, in The Waves largely disappear when we read Woolf’s diaries and letters alongside biographies by writers like her nephew Quentin Bell, Phyllis Rose and Lyndall Gordon. In so doing it becomes clear that Woolf’s own life provides the subject-matter, or plot, upon which her experimental, poetic novels are constructed […]. Whether a work of fiction ought in fact to be self-sufficient remains a question of critical debate.11
Wheares Überlegungen sind beispielhaft für die mehrheitliche Überzeugung einer repräsentativen Funktion von Literatur, die sowohl The Picture of Dorian Gray als auch Mrs. Dalloway problematisieren und auch der/die jeweilige Autor_in in ihren Schriften stets ablehnen. Wheare postuliert dabei zunächst eine fragwürdige Opposition zwischen Form und Inhalt in Woolfs Literatur, findet die essenzielle Bedeutung der Texte durch biographische Bezüge und stellt schließlich den Wert einer solch selbstgenügenden Literatur infrage. Anstatt Woolfs Bemühungen, etablierte Identitätsparameter zu denaturalisieren als eine Errungenschaft anzuerkennen, die ›Künstlichkeit‹ der Texte als ein notwendiges Spiel mit einengenden Konventionen, wird die ›formale Obskurität‹ ihrer Schriften als ein Verschleiern des ›wahren‹ behandelten Gegenstandes angesehen. Es mag schon sein, dass die unterstellte Verworrenheit und Unzugänglichkeit der Texte verschwindet, wenn Literatur biographisch verknüpft wird. Aber weitaus mehr verschwindet durch die wiederholten auktorialen Klärungsbemühungen, denn solch ein »restrictive discourse […] performs as a regulatory operation of power that naturalizes the hegemonic instance and forecloses the thinkability of its disruption.«12
Sowohl The Picture of Dorian Gray als auch Mrs. Dalloway »reject conventional either/or dichotomies in favor of employing more diverse both/and dispositions.«13 Aber diese Ambiguität muss scheinbar immer wieder ›korrigiert‹ werden, um die Polaritäten aufrecht zu erhalten, durch die Identität generell konzipiert wird. Sowohl die gängige Rezeption der Romane als auch ihre literarischen Neuaneignungen überlesen und überschreiben ihre genuine, queere Disruption gängiger Attributionen und weisen die Texte dadurch in ihre kategorischen Schranken. Eine durchgängige Prämisse der kritischen und literarischen Auseinandersetzungen scheint zu sein, dass die mittlerweile gängige Vorstellung von Homosexualität als einer essenziellen Identität, die sich zu Wildes und Woolfs Zeiten wissenschaftlich erst formierte, den Autor_innen noch nicht in dieser Form zur Verfügung stand. Die auffällige Verschwiegenheit und Unfassbarkeit der Texte von Wilde und Woolf wird also kausal mit der damaligen gesellschaftlichen Verschwiegenheit über und Unfassbarkeit von gleichgeschlechtlichem Begehren verbunden. Die damalige gesellschaftliche Ächtung gleichgeschlechtlichen Begehrens und Unmöglichkeit einer dezidiert homosexuellen Identität wird als schriftstellerische Hürde beziehungsweise Grund für ein notwendiges, codiertes Umschreiben gedeutet. Doch ist es genau dieses mittlerweile naturalisierte Verständnis von essenziellen, sexuellen und geschlechtlichen Identitäten und einer historisch wachsenden, sexuellen Befreiung, das meines Erachtens umgekehrt eine Hürde für umsichtigere Annäherungen an die queere Verfasstheit der Romane darstellt. Die diskursiv übermächtige, heteronormative Identitätsmatrix verstellt dabei den Blick auf die Performativität der eigenen Kategorien, die durch die Erzählungen ausgestellt wird. Die essenzialisierte, symbolische Ordnung schürt ein Misstrauen gegenüber allen Subversionsbestrebungen, die sich nicht in ihre binären Strukturen einfassen lassen und einen größeren, uneindeutigeren Raum für Seinsmöglichkeiten behaupten und bereitstellen. Die diskursiven Begradigungen queerer Texte leugnen deshalb die Signifikanz, die nicht nur ästhetische, sondern ethische Motivation des permanenten Spiels, des semiologischen Infragestellens, der notwendigen Verunsicherung etablierter Bedeutungsmuster von Text und Sex. Schließlich ist Sprache nicht Ausdruck, sondern Bestimmung unseres Seins und das Bemühen um die Öffnung und Umordnung von Bedeutungsmustern öffnet und rekonfiguriert mögliche Lebensformen und -bedingungen.
Das Zusammenwirken von Sprache und Wirklichkeitserfahrung wird in der gängigen Vorstellung biographisch repräsentativ und nicht als über sich selbst hinausweisend verstanden. Dies hat auch zum mittlerweile fragwürdigen Status der queeren Theorien geführt, die sich im Zuge poststrukturalistischer Überlegungen ja gerade durch eine anti-identitäre Ausrichtung auszeichneten, einem Verständnis von Identität als nicht naturgegeben, sondern performativ erzeugt. Die textliche Devianz von The Picture of Dorian Gray und Mrs. Dalloway wird jedoch als in der sexuellen Abweichung der Autor_innen begründet verstanden. Ein Zirkelschluss, der das Wirkungspotenzial der Erzählungen deutlich mindert. Die Kritik an naturalisierten Kategorien wird so zu einer literarischen Verschleierungstaktik umgedeutet, begründet in der Angst ihrer Enttarnung als Homosexuelle. Bereits 1895 wurde The Picture of Dorian Gray bei Oscar Wildes Gerichtsverhandlung wegen Unzucht herangezogen, um die sexuelle Perversion des Autors zu beweisen. Und auch wenn wir in unseren ›aufgeklärten‹ Zeiten Oscar Wilde nicht mehr für seine ›Homosexualität‹ inhaftieren würden, so ist zumindest dieser Roman in den Fesseln essenzieller Lesarten in Identitäts-Haft genommen worden.
Vor allem das Überlesen einer Romanfigur, die man durchaus als eloquenten Vorfahren queerer Überlegungen verstehen kann, erscheint mir eine fatale Verkennung der Subversionsbestrebungen von The Picture of Dorian Gray zu sein. Lord Henry Wotton, der »man of words« oder »Prince Paradox« wie er von den Anderen genannt wird, ist der unbestreitbare Wortführer, wenn es um das semiologische Spiel mit essenzialisierten Identitäten geht. Doch wird gerade er vor allem als dekadenter Dandy gelesen, dessen Wortgewandtheit zumindest teilweise für den moralischen Verfall und frühzeitigen Tod Dorian Grays verantwortlich ist. Zumeist werden seine Epigramme und Paradoxien als Slogans für eine hedonistische, moral- und konventionsbefreite Lebensgestaltung gelesen oder sie figurieren als comic relief in einer ansonsten düsteren Geschichte. Aber wenn wir seine Anzweiflung aller essenzialisierten Wahrheiten und naturalisierten Konventionen als durchaus ethische Haltung und Henry Wotton somit als Vorfahren einer queeren Politik lesen, ändert sich nicht nur der Blick auf seinen Charakter, sondern auch die Rezeption des Romans als Ganzem.
Was passiert also wenn wir seinen Humor als eine seriöse Strategie verstehen, heteronormativen und essenziellen Denkweisen entgegenzutreten? Könnte sein permanentes Umkehren und Verhöhnen von etablierten Vorstellungen dann nicht als ein wirkmächtiger und ethisch motivierter Versuch verstanden werden, den – so Roland Barthes – »größten Feind, die bourgeoise Norm«14 und ihre mythologisierten Grundsätze zu destabilisieren? Wottons rhetorische Umkehr von naturalisierten Ideen lässt sich als eine mögliche, queere Interventionsstrategie in Judith Butlers Überlegungen wiederfinden, wenn sie beispielsweise ausführt, dass »to contest symbolic authority is […] to insist that the norm in its necessary temporality is opened to a displacement and subversion from within.«15 In diesem Licht betrachtet figuriert Wottons Humor nämlich genau als eine Instanz queerer Subversion, eine Subversion, die ihm in der Logik des Romans auch das Überleben sichert. Die Berücksichtigung des »Mannes der Worte« führt mindestens zu einer Erweiterung der gängigen Annahme, dass das Romanende als poetische Gerechtigkeit für Dorian Grays Verfehlungen anzusehen ist. Das Überleben des Essenz- und Identitätsverweigerers Wottons und der Tod Dorian Grays durch den eigenen Versuch, seinen ›Teufelspakt‹ durch die Vernichtung des Ab-Bildes zu annulieren, zeigen dann vielmehr, dass die ›Moral der Geschichte‹ eine weitreichendere ist. Sterben müssen demnach alle, die nach Essenzen und Wahrheiten in der Performativität unseres Seins suchen und sich selbst und andere damit festschreiben. Leben kann hingegen nur, wer sich naturalisierten Identitäten widersetzt.
Wottons Sprachwitz verweist gleichzeitig auf die ansonsten pausenlose Verdrängung einer zugrundeliegenden Ambiguität und Artifizialität unserer Identitätsverständnisse und die Möglichkeit, diese Uneindeutigkeit und Künstlichkeit zu genießen anstatt sie zu fürchten. Butler weist in ihrer Einleitung zu Undoing Gender ebenfalls auf eine grundsätzliche, (über)lebensnotwendige Unbestimmbarkeit unseres Seins hin: »There is always a dimension of ourselves and our relation to others that we cannot know, and this not-knowing persists with us as a condition of existence and, indeed, of survivability.«16 In literarischer Übereinstimmung mit solch aktuellen, queeren Theorien präsentiert The Picture of Dorian Gray alle Versuche, grundlegende Wahrheiten zu (er)kennen, zu beanspruchen oder zu repräsentieren als todbringend. Der Roman kontrastiert Wottons spielerischen Wortwitz, der sich Stillstellungen und Definitionen widersetzt, mit den Bemühungen der anderen Charaktere, die »eine, wahre Bedeutung« hinter einer imaginierten Zeichenoberfläche zu finden. Diese Versuche entpuppen sich nicht nur als ständige Missverständnisse, sondern bringen Gewalt und Tod mit sich. Im Gegensatz zu der ›Ernsthaftigkeit‹, mit der die anderen Protagonist_innen des Romans auf eine allgemeingültige Realität und Wahrheit beharren, berücksichtigt Wottons queere Perspektive, um es mit Butler zu sagen, »a certain openness and unknowingness. It also implies that a certain agonism and contestation will and must be in play. They must be in play for politics to become democratic.«17 Wottons Humor ist in diesem Zusammenhang sicher ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite bringen seine Bemerkungen einen Unterhaltungsmehrwert mit sich und sind erheiternde Momente in einer ansonsten eher tristen Umgebung. Andererseits birgt genau dieser Wortwitz das Risiko, nicht ernst genommen zu werden, wie es ja auch in den meisten Lesarten deutlich wird, die ihn ihm lediglich einen ziellos-dekadenten Poseur sehen.
The Picture of Dorian Gray insinuiert allerdings mehrfach, dass derartige Lesarten auf falschen Oppositionen basieren, in denen beispielweise Aspekte von Spiel und Genuss traditionell aus »ernsten Angelegenheiten« fern gehalten werden. Henry Wotton bemerkt hierzu: »Humanity takes itself too seriously. It is the world’s original sin. If the cavemen had known how to laugh, History would have been different.« (56) Die Fähigkeit des Lachens und Sich-lustig-machens über naturalisierte Mythen anstatt diese als verbindlich anzuerkennen, weist auf die Möglichkeit eines Widerstandes hin und zudem auf die Möglichkeit, diese Form des Widerstandes gegen eine eingrenzende Sprache zu genießen. Die dramatische Entfaltung der Geschichte macht deutlich, dass Wottons rhetorische Zurückweisungen von Allgemeinplätzen und sogenanntem Allgemeinwissen momentane Schlupflöcher innerhalb einer heteronormativen, symbolischen Ordnung bereitstellen. Die etablierte Interpretation von Wottons Wortwitz als dekadente Propaganda gründet also ausschließlich auf der Annahme von Ethik als eine dezidierte Position, eine Orientierungsmöglichkeit, die notwendiger- und richtigerweise normativ figuriert. Diese scheinbar selbstverständliche Verknüpfung von Normativität und Ethik verfährt allerdings nach einem Ausschließungsprinzip, das gerade durch den Humor des Dandys kritisch hinterfragt wird. Butler reflektiert ebenso kritisch diese Doppeldeutigkeit von Normativität:
But consider that normativity has this double meaning. On the one hand, it refers to the aims and aspirations that guide us, the precepts by which we are compelled to act or speak to one another, the commonly held presuppositions by which we are oriented, and which give direction to our actions. On the other hand, normativity refers to the process of normalization, the way that certain norms, ideas and ideals hold sway over embodied life, provide coercive criteria for normal »men« and »women.« And in this second sense, we see that norms are what govern »intelligible« life, »real« men and »real« women. And that when we defy these norms, it is unclear whether we are still living, or ought to be, whether our lives are valuable.18
Wotton spricht niemals »im Namen« einer Norm, sondern gegen die Naturalisierung und Festschreibung dieser Namen, aus denen eingrenzende und zwingende Zuweisungen geworden sind. Sein Sprachvermögen, das sich durch Wortwitz, Sarkasmus und Paradoxien auszeichnet, betont den performativen Aspekt von Signifikanzen und ermöglicht in der rhetorischen Destabilisierung neue Bedeutungs- und Handlungsspielräume. Wie Wotton selbst anmerkt: »Well, the way of paradoxes is the way of truth. To test reality we must see it on the tight rope. When the verities become acrobats, we can judge them.« (55) Das größte Anliegen des Dandys, das sich in seinen Äußerungen manifestiert, ist die Aufweichung verfestigter Vorstellungen, die er als nicht natürlich, sondern naturalisiert ausstellt. Sein Witz ist eine rhetorische Maßnahme, die darauf verweist, dass keine Aussage jemals etwas Wahres über uns oder Andere ›ausdrückt‹, sondern wir in dem Wunsch nach Verständigung und Anerkennung mit einem artifiziellen Medium – der Sprache – gezwungen werden, durch Wiederholung gemeinhin soziale Konventionen zu paraphrasieren und sedimentieren. Für Henry Wotton ist dieser wiederholende Gebrauch der Sprache eine Verhinderung von Potenzialen und verantwortlich für vorgeschriebene Standards und konsolidierte Mythen, die zum Ausschluss und der Oppositionierung nicht-konformer Performanzen führen. Sein Wortspiel bemüht sich folglich, diskursiv naturalisierte Bedeutungszusammenhänge zu dekonstruieren. In einer Konversation mit seiner Kusine bemerkt er dazu Folgendes:
I hope Dorian has told you about my plan for rechristening everything, Gladys. It is a delightful idea. It is a sad truth, but we have lost the faculty of giving lovely names to things. Names are everything. I never quarrel with actions. My one quarrel is with words. That is the reason I hate vulgar realism in literature. The man who could call a spade a spade should be compelled to use one. (206)
Wottons Verweis auf und Rekonfigurierung der geläufigen Redewendung »to call a spade a spade« figuriert hier als sarkastischer Verweis auf all jene, die etablierte Konzepte als Wahrheiten ansehen, diese weiter tradieren und damit zu Totengräbern der Sprachmöglichkeiten werden. Anstatt den Exzess von Bedeutungsmöglichkeiten wertzuschätzen, durchtrennen und limitieren sie den Fluss, oder – wie Roland Barthes es formuliert – die »Galaxie von Signifikanten«. Wotton widmet sich dem performativen Charakter der symbolischen Ordnung von Identitäten spielerisch und nicht essenziell. In der Logik und Dramatik des Romans wird deutlich, dass seine Akzeptanz von genereller Unsicherheit und Uneindeutigkeit im Gegensatz zu den anderen Romanfiguren eine bewusste ist und damit nicht fatal wird. In seiner Undefinierbarkeit ist er ungebunden und bleibt lebendig, während die anderen Charaktere festgelegt und stillgestellt werden und schließlich einen frühzeitigen, gewaltsamen Tod finden.
Vielleicht sind es The Picture of Dorian Grays deutliche Verweise auf klassische Mythen und die scheinbar offensichtliche Einschreibung in das Genre des Schauerromans mit seiner charakteristischen Fokussierung auf Moralfragen und Momente der Transgression von Konventionen, die eben auch zu schwerwiegenderen Festschreibungen – von Text, Figuren und Autor – in der Rezeption und Adaption geführt haben. So ist die Moral oder auch Amoral der Geschichte eine der meistdiskutierten Fragen und wird zum zentralen Ausgangspunkt von Will Selfs Dorian. An Imitation als auch Jeremy Reeds Dorian. A Sequel. In den beiden Adaptionen von The Picture of Dorian Gray wird die scheinbare Frage von Moral und Verfehlung, von rücksichtslosem Hedonismus und dem wahren Schönen, von Oberfläche und Tiefe in dezidierter Weise geschildert. Jede Ambivalenz und Mehrdeutigkeit geht in der Entschiedenheit der moralischen Positionierung dabei verloren. Hier wird der gesellschaftlichen Korruption, der Dekadenz der Figuren eine grundsätzliche Wesensart und nicht Lesart unterstellt. Alle sexuellen und drogenbegleiteten Exzesse werden hier ausbuchstabiert, werden zur Triebfeder der neuen Geschichten und lassen keinen Raum mehr für Spekulationen.
Doch die Frage von Moral ist in Wildes Roman eben keine handlungsorientierte, keine sexuell orientierbare und auch keine von sexuellen Handlungen motivierte Frage. In der Logik von The Picture of Dorian Gray ist die Inanspruchnahme einer ›richtigen‹ und ›wahren‹ Position, die ›Wahr‹-nehmung und Behauptung einer natürlichen und nicht symbolischen Ordnung unmoralisch. Wenn Wotton also behauptet, dass »Names are everything. I never quarrel with actions. My one quarrel is with words«, ist dies keine Verantwortungsflucht oder dekadente Pose. Im Gegenteil figuriert sie in Wildes Roman als ein Leitspruch einer ernstzunehmenden Haltung, die sich ebenfalls in Roland Barthes Überlegungen zum Mythos wieder findet:
For if there is a »health« of language, it is the arbitrariness of the sign which is its grounding. What is sickening in myth is its resort to a false nature, its superabundance of significant forms, as in these objects which decorate their usefulness with a natural appearance. The will to weigh the signification with the full guarantee of nature causes a kind of nausea: myth is too rich, and what is in excess is precisely its motivation.19
Die neusten Rezeptionen und Adaptionen von The Picture of Dorian Gray und Mrs. Dalloway mythologisieren die queeren Anti-Mythen von Wilde und Woolf, indem sie das scheinbar Ausweichende und Künstliche für die Schwachstellen der Erzählungen halten. Dabei geht es in beiden Romanen genau um die Gesundheit einer ent-naturalisierten Sprache, die Gesundung durch das subversive Spiel mit Identität, um den Genuss und die Lebendigkeit, die durch die Erneuerung, Rekonfiguration und alternative Kontextuierungen von Bedeutungen möglich werden. Damit soll nicht abgestritten werden, dass sexuelle Abweichungen, unkonventionelle Beziehungskonstellationen und gleichgeschlechtliche Begehrensstrukturen die Texte durchkreuzen. Aber die sprachlichen Rekonfigurierungen und Aussparungen führen gerade nicht in die Irre, ins Leere oder sind Ablenkungen vom eigentlichen, wesentlichen Erzählgegenstand aus Angst vor Enttarnung. Es geht nicht um internalisierte Homophobie. Im Gegenteil, sie deuten den einzigen, lebenswerten Ausweg aus kategorischen Gefängnissen, zeigen die Möglichkeit, sich von der Last ihrer Festschreibung zu trennen und so einem eigentlicheren, komplexeren Selbstgefühl näher zu kommen. Die einzige alternative Fluchtmöglichkeit aus dem symbolischen Gefängnis ist der Tod. Diese – endgültige – Möglichkeit, der heteronormativen Ordnungspolizei zu entkommen, dramatisieren beide Romane ebenfalls mit dem Tod einer jeweiligen Hauptfigur. In der selbstreflexiven Konzipierung der Romane könnten sie auch als literarische Umsetzung des von Roland Barthes geforderten »Tod des Autors« zugunsten eines pluralen, bedeutungs-multiplizierenden Textes figurieren:
With regard to the plural text, forgetting a meaning cannot therefore be seen as a fault. […] Reading does not consist in stopping the chain of systems, in establishing a truth, a legality of the text […], it consists in coupling these systems, not according to their finite quantity, but according to their plurality. […] Forgetting meaning is not a matter for excuses, an unfortunate defect in performance, it is an affirmative value, a way of asserting the irresponsibility of the text, the pluralism of systems.20
Das genuine Vergessen von Bedeutung und die verantwortungsbewusste Unverantwortlichkeit der Texte werden in den anti-queerenden Lesarten und Neuschreibungen sowohl von The Picture of Dorian Gray als auch Mrs. Dalloway weitestgehend missachtet, ja sogar als beklagenswerte Verfehlungen der Romane und ihrer Autor_innen aufgegriffen. Diese Herangehensweise ist nicht nur antiqueerend, sondern markiert auch einen diskursiven Backlash, die Rückwendung hin zu einer fragwürdigen Vorstellung von ›guter Literatur‹ als realistisch und repräsentativ, die Foucault in seinen Überlegungen zur Autor-Funktion bereits als überwunden erachtet hatte:
the writing of our day has freed itself from the necessity of »expression«; it refers only to itself, yet is not restricted to the confines of interiority [but] transforms writing into an interplay of signs, regulated less by the content it signifies than by the very nature of the signifier […] an action that is always testing its limits of its regularity, transgressing and reversing an order it accepts and manipulates.21 [meine Ergänzung; D.S.]
Foucaults Ausführungen könnten nicht angemessener beschreiben, was das Anliegen und die Konzipierung der beiden hier diskutierten Romane angeht. Beide bemühen sich um die Bloßstellung und die spielerische Hinterfragung von Konventionen und essenzialisierten Identitäten. Das Überschreiten und Durchkreuzen von naturalisierten Mythen, das Spiel mit etablierten Erzählmustern ist aber nicht nur eine literarische Pose und schon gar keine Selbstverleugnung der Autor_innen. Die Erzählungen offerieren die Möglichkeit und postulieren die Notwendigkeit, sich von diskursiven Zwangsjacken zu befreien, um überleben zu können. Dies wird durch die Romane nicht nur als schriftstellerisch-ästhetische, sondern als eine menschlich-ethische Herausforderung vermittelt.
Während sich das augenfällige, anti-mythische und anti-essenzialistische Design des Romans The Picture of Dorian Gray durch seine markanten Rückbezüge zum Faust- und Narziss-Mythos auszeichnet und mit Lord Henry Wotton zudem einen extrovertiert eloquenten Queerulanten präsentiert, ist Virginia Woolfs Erzählung deutlich introvertierter. Aber nicht weniger konsequent. Mrs. Dalloway ist gleichfalls anti-mythisch und anti-identitär konzipiert und zwar durch seine – trotz aller intertextuellen Referenzen – vor allem sich selbst konstruierenden und gleichzeitig dekonstruierten Momente. Die Erzählung bricht deutlich mit den Konventionen und traditionellen Erwartungen an eine Narration. Wie Elizabeth Abel beispielsweise beobachtet, präsentiert Mrs. Dalloway »a clandestine story that remains almost untold, that resists direct narrative and coherent narrative shape. Both intrinsically disjointed and textually dispersed«22 erzählt der Roman die physischen, aber vor allem gedanklichen Reisen mehrerer Charaktere innerhalb eines Tages. Die vorgestellten figuralen und konfiguralen Bewegungen unterminieren allerdings die mit dem Reisen gängigerweise assoziierten linearen Konzepte von Beginn und Ende, Aufbruch und Ankunft, einem Ziel vorwärts gerichtet entgegensteuernd. Damit nimmt Mrs. Dalloway bereits die Antwort auf Barthes fünf Jahrzehnte später formulierte Frage vorweg, nämlich: »What would be the narrative of a journey in which it was said that one stays somewhere without having arrived, that one travels without having departed – in which it was never said that, having departed, one arrives or fails to arrive?«23
Die semiologische ›Sperrigkeit‹ des Romans von Virginia Woolf ist augenscheinlich größer als die von The Picture of Dorian Gray. Wildes Roman kann als invertierter Bildungsroman mit einem klassischen Spannungsverlauf verstanden und linear nachvollzogen werden. Der Zugang zu den Hauptfiguren erschöpft sich dort mehrheitlich in ihrer Funktion – Basil Hallward, der Künstler, Sybil Vane, die Schauspielerin, Dorian Gray, das Schönheitsideal und Henry Wotton, der Mann des Wortes. Die Artifizialität des Erzählens begründet sich in The Picture of Dorian Gray also vor allem darin, dass die Charaktere selbst als Artefakte konzipiert sind und zunächst eher eindimensional und definiert erscheinen. In Mrs. Dalloway hingegen ist die Orientierung augenfällig erschwert durch eine Vielzahl von Figuren, deren parallelisierte Bewusstseinsströme ebenbürtig mit ihren entäußerten Gedanken vermittelt werden. Dadurch wird von Beginn an eine größere psychologische Tiefe suggeriert und die figurale Orientierung deutlich kompliziert. Die ›Handlung‹ beschränkt sich auf einige wenige ›Ereignisse‹ an einem einzigen Tag und der erwartete Höhepunkt, die große Party, die Mrs. Dalloway am Abend gibt, ist ein sich selbst entkommendes und auch nicht abschließendes Ereignis innerhalb der Erzählung.
Doch der Zugang zu den Gedanken der Protagonist_innen lässt auch in Woolfs Roman keine Rückschlüsse auf eine stabile und essenzielle Identitätsfindung beziehungsweise -zuschreibung zu. Es wird damit auch kein tieferes, authentisches Ich-Empfinden vermittelt, welches einer sozialen, oberflächlicheren Identität zugrundeliegen würde. Das Gefühl von Entfremdung, Instabilität und Uneindeutigkeit ist allgegenwärtig und dieser sine qua non ist nicht anders beizukommen, als die Performativität, Ambivalenz und Unbestimmbarkeit des Seins zu akzeptieren:
She would not say of anyone in the world now that they were this or that. She felt very young; at the same time unspeakably aged. She sliced like a knife through everything; at the same time was outside, looking on […] and she would not say of Peter, she would not say of herself, I am this, I am that. (9)
Wenngleich Clarissa Dalloway die meisten ihrer Gedanken ihrer Umwelt nicht mitteilt, wird ihre Akzeptanz der ultimativen Unbestimmbarkeit von Sein und Schein deutlich und auch die Einsicht in die Notwendigkeit, der performativen und symbolischen Ordnung von Identität durch Rekonfigurationen zu begegnen. Und durch Behutsamkeit. In ihrem Fall ist die Party eine Möglichkeit, Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen und dabei ist die Oberflächlichkeit und Unzuverlässigkeit, die sich aus der Größe und Mischung der versammelten Gesellschaft ergibt, durchaus willkommen, weil sich Essenzen und Wahrheiten notwendiger Weise der Kommunikation mit Anderen, ›Fremden‹ widersetzen. In Clarissas Vorstellung sind die jeweils bedeutungsstiftenden Lebensinhalte sowieso gar nicht vermittelbar, sondern müssen unausgesprochen bewahrt werden, um ihre Größe und Kraft nicht zu verlieren und durch konventionalisierte Bedeutungsmuster banalisiert zu werden:
A thing there was that mattered; a thing, wreathed about with chatter, defaced, obscured in her own life, let drop every day in corruption, lies, chatter. This he had preserved. Death was defiance. Death was an attempt to communicate, people feeling the impossibility of reaching the centre which, mystically, evaded them; closeness drew apart; rapture faded; one was alone. There was an embrace in death. But this young man had killed himself – had he plunged holding his treasure? »If it were now to die, ‘twere now to be most happy,« she had said herself once, coming down, in white. (202)
Auch wenn in Clarissa Dalloways Reflexionen über den Selbstmord von Septimus Warren Smith eine Sehnsucht der Protagonistin deutlich wird, eine Essenz in der Galaxie der Signifikanten zu finden und zu bewahren, sich verständlich oder begreiflich machen zu können, sind doch die letzten Gedanken nicht frei von Ironie, denn sie sind ein Zitat. Sie sind also alles andere als eine originäre, authentische Gefühlsäußerung. Sie sind Worte eines mythologisierten Dichters, gesprochen von Othello, einem ›Mohr‹, einem Mann, millionenfach zitiert. Die Suche nach Authentizität und Essenz führt also auch Clarissa geradewegs zur Imitation, in diesem Fall auch bemerkenswerterweise zu einer, die sich cross-gendered und cross-raced gestaltet. Die Szene zeigt exemplarisch, wie Mrs. Dalloway die Leseerwartungen immer wieder ins Leere laufen lässt, wenn man nach einer ›wahren‹ Identität, essenzieller Bedeutung sucht. Auch nach einer sexuellen. Das Spiel mit Erwartungen, die permanente Um- oder Abkehr von essenziellen und realistischen Ansprüchen eint The Picture of Dorian Gray und Mrs. Dalloway. Repräsentiert werden hier keine homo- oder heterosexuelle Identitäten, sondern die nicht zu lösende Verbindung von Schreib- und Seinsweisen.
Die queere Errungenschaft der Texte liegt also genau in der Ausstellung der Künstlichkeit von Identitäten, die nur mit Hilfe ihrer Wiederholungen natürlich werden und gültig bleiben. Queeres Schreiben bedeutet anti-identitäres Schreiben, nicht aus Furcht vor individueller Entdeckung, sondern vor seiner allgemeinen Verkennung:
For to escape both the constrictions of a sexuality that is silenced and the dangers of a sexuality inscribed as essential, we must construct […] a difference from the heterosexual logic of identity – propped up as it is by the notion of a disavowed and projected sexual difference – in order to deconstruct the repressive ideology of similitude or identity itself.24
Das Fazit der hier vorgestellten Überlegungen ist also, dass anstelle von Konklusionen und Essenzen Konfusionen und Dissenzen als wichtige und auch ethische Strategien queerer Texte anerkannt werden sollten. Trotz unbestreitbarer Differenzen haben The Picture of Dorian Gray und Mrs. Dalloway diesbezüglich einen wichtigen und gemeinsamen queeren, nicht homosexuellen Erzählgegenstand. In beiden Romanen wird eine symbolische, naturalisierte Ordnung von Identität als Gefahr und Beschränkung für individuelle und potenzielle (Selbst-)Verständnisse verstanden. Die Erzählungen verdeutlichen, wie (Zeichen-)Sprache unsere Wirklichkeitserfahrung nicht vermittelt, sondern bestimmt und zur Sinnhaft wird. Es gibt keine natürliche oder authentische Beziehung zwischen Sprache und Wirklichkeit, sondern lediglich eine konventionelle. Dennoch werden Bedeutungen durch ihre fortwährende Wiederholung naturalisiert und damit zu einer einengenden Identitätsbestimmung, welche die Komplexität des individuellen Empfindens aberkennt. Solche Zu- und Fest- und Überschreibungen werden in beiden Romanen sogar als persönliche, existenzielle Bedrohungen thematisiert, der nur durch Unvoreingenommenheit und einen spielerischen Umgang mit Bedeutungen zu entkommen ist.
Wildes Roman zeigt, welche fatale Auswirkungen Dorians Tauschpakt mit seiner Abbildung hat, da er von diesem Moment an fest an diese gebunden bleibt. Er ist augenblicklich als Schönheitsideal und begehrtes Objekt definiert und muss feststellen, dass sein Wahrnehmungs- und Handlungsspielraum dadurch erheblich eingeschränkt ist, weil er eindeutig und damit ›falsch‹ gesehen wird. Durch seine eigene, kontinuierlich steigende Ablehnung seiner bildlich festgehaltenen ›Repräsentation‹, welche eben nur ein Bild ist und seine Komplexität nicht dar- sondern verstellt, werden seine ›Fluchtversuche‹ immer dramatischer, bis er am Ende Selbstmord begeht. Dorians Schicksal ist daher weniger eine Frage der Moral (ein wiederkehrender Gesichtspunkt innerhalb der Rezeptionsgeschichte des Romans) als das Resultat einer als unwahr empfundenen, weil festschreibenden Repräsentanz seines Ichs. Es ist die Figur des Lord Henry, ein Charakter welcher bislang vorwiegend vor dem Hintergrund seiner angeblich ›unmoralischen‹ Wertvorstellungen und seines verheerenden Einflusses auf Dorian negativ in Betracht gezogen wird, der als ein queerer Wortführer für einen offeneren und befreienden Umgang mit Bedeutungen verstanden werden kann. Ihm gelingt es – als einzige Hauptfigur des Romans – zu überleben, eine Tatsache, die in der Logik des Romans sowohl das sprichwörtliche Leben als auch seine undefinierbare Existenz bedeutet. Seine Paradoxien sind demnach mehr als nur witzige Posen eines Dandys. Sie sind Verweise auf die mögliche Verdrehung und Umkehrung von Bedeutungen und damit auch subversive Strategien, um die Absurdität und Künstlichkeit von essenziellen Vorstellungen von Identität herauszustellen.
Hier weist Virginia Woolfs Mrs. Dalloway deutliche Parallelen auf. So schildert der Roman immer wieder Momente, in denen der Wunsch nach einer wahren und anhaltenden Bedeutungsfindung durch momentane Irritationen und verschiedenen Sichtweisen unmöglich gemacht wird. Wie The Picture of Dorian Gray stellt Mrs. Dalloway einen Anspruch auf Allgemeingültigkeit und authentische Repräsentation immer wieder der individuellen Empfindung einer damit nicht zu vereinbarenden Komplexität entgegen. Wie in Wildes Roman stirbt ein Charakter sinnbildlich und sprichwörtlich an den Folgen von symbolischen Festschreibungsversuchen, während eine andere Figur in ihrer Akzeptanz und einem spielerischen Umgang mit der Unnatürlichkeit von performativer Kongruenz überlebt. So wird dem von Septimus Warren Smith artikulierten, ›besonderen‹ Wirklichkeitsempfinden der Sinn einfach abgesprochen. Seine Äußerungen und damit er selbst werden als wahn-sinnig und damit als bedeutungslos gewertet und durch diese Zuschreibung aus der heteronormativen Ordnung von Identität ausgrenzbar. Dieser Ausschluss aus einer symbolischen Gemeinschaft vollzieht sich in einer so gnadenlosen und absoluten Form, dass sein tödlicher Sprung aus dem Fenster eine logische Konsequenz für eine ansonsten unmögliche, weil allgemein nicht verständliche Existenz scheint. Clarissa Dalloway hingegen überlebt, denn sie ist durch ihre Abwendung von kategorialen und essenziellen Lesarten in der Lage, auch ihre eigene empfundene Uneindeutigkeit zu bewahren.
Die destabilisierenden und anti-essenziellen Entwürfe der Romane antizipieren bereits deutlich sowohl Roland Barthes’ Überlegungen zum naturalisierten Mythos als auch Judith Butlers Kritik an der heteronormativen Ordnung von Geschlecht und Sexualität. Die bewusst ambivalenten Gestaltungen von The Picture of Dorian Gray und Mrs. Dalloway werden gerade in einer parallelen Lektüre als genuin queere, anti-mythische Subversionsversuche und keinesfalls als Verschleierungsversuche verstehbar. Im Gegenteil zeigen die Romane, mit welch fatalen Konsequenzen Zu- und Fest-schreibungen individuelle Lebensmöglichkeiten in Haft nehmen können oder sogar eliminieren. Die queere Gestaltung der Erzählungen problematisiert den untrennbaren Zusammenhang von textueller und sexueller Identität und zeigt Möglichkeiten, sich gegen festschreibende Definitionen und Kategorien aufzulehnen, die unser Leben nicht so sehr als Orientierungshilfen vereinfachen als vielmehr unsere Zugangs- und Entfaltungsmöglichkeiten beschneiden. Das heutige Verständnis von queer ist allerdings scheinbar weitestgehend ein kategorisches und identitätspolitisches. Als homosexueller Diskurs wird queer dem heterosexuellen Diskurs gegenübergestellt. Darum überlesen und überschreiben die Neuschreibungen von und die literaturkritischen Annäherungen an die Erzählungen von Wilde und Woolf die uneindeutigen, anti-repräsentativen Momente. Schließlich lässt sich die Homosexualität der Autor_innen kaum leugnen und die Heteronormativität von Identität darf nicht angezweifelt werden und muss diskursiv gesichert bleiben. Daher müssen queere Interventionen entweder als nicht-heterosexuelle ausgrenzbar sein, oder als un-natürliche, künstliche Posen, die eine wahre, grundlegende Identität verschleiern sollen, interpretiert und überschrieben werden. Aber, wie schon Henry Wotton in The Picture of Dorian Gray sagt: »Being natural is simply a pose. And the most irritating pose I know.« (22)
Literaturverzeichnis
ABEL, Elizabeth: »Narrative Structure(s) and Female Development: The Case of Mrs. Dalloway«. In: Harold Bloom (Hg.): Virginia Woolf’s Mrs. Dalloway: Modern Critical Interpretations. New York 1988, S. 103–127.
BARTHES, Roland: Image / Music / Text. Trans. Stephen Heath. 1986 [1977].
BARTHES, Roland: Mythologies. Trans. Annete Lavers. New York 1972.
BARTHES, Roland: S/Z. An Essay. Trans. Richard Miller. New York 1974.
BARTHES, Roland: The Pleasure of the Text. An Erotics of Reading. Trans. Richard Miller. New York 1975.
BUTLER, Judith: Undoing Gender. New York 2005.
EDELMANN, Lee: Homographesis: Essays in Gay Literature and Cultural Theory. New York 1994.
FOUCAULT, Michel: The Archaeology of Knowledge. Trans. Alan Sheridan Smith. London 1974.
FOUCAULT, Michel: »What is an Author?« Trans. Donald F. Bouchard and Sherry Simon. In: Donald F. Bouchard (Hg.): Language, Counter-Memory, Practice. New York 1977 [1970] S. 113–138.
GILLESPIE, Michael Patrick: Oscar Wilde and the Poetics of Ambiguity. Gainesville 1996.
WHEARE, Jane: »Introduction«. In: Virginia Woolf: The Voyage Out. London 1992, S. ix–xxxvii.
WILDE, Oscar: The Picture and Dorian Gray and Selected Stories. New York 1983.
WILDE, Oscar: »Phrases and Philosophies for the Use of the Young«. In: Collins Complete Works of Oscar Wilde. Glasgow ⁵2003 [1894], S. 1244–1245.
WOOLF, Virginia: Mrs. Dalloway. London 1992 [1925].
WOOLF, Virginia: »Modern Fiction«. In: Mitchell A. Leaska (Hg.): The Virginia Woolf Reader. San Diego 1984 [1925], S. 283–292.
- 1. Judith Butler: Undoing Gender. New York 2005, S. 35.
- 2. Von diesen Adaptationen bewahrt The Hours wohl am ehesten die queere Qualität seines Vorbilds und kann im Gegensatz zu den anderen Texten als Weiter- und nicht Überführung der literarischen Quelle verstanden werden. Allerdings suggeriert das Romanende dann doch eine genealogische und nicht performativ-symbolische Kausalität von Identitäten.
- 3. Zu einer ausführlicheren Darlegung der hier skizzierten Problematik inklusive kritischer Heranziehung der Adaptionen und ausführlicher Berücksichtigung der ›Sekundärliteratur‹ siehe Dirk Schulz: Setting the Record Queer. Rethinking Oscar Wilde’s The Picture of Dorian Gray and Virginia Woolf’s Mrs. Dalloway. Bielefeld 2011.
- 4. Es gibt seltene Ausnahmen, wie beispielsweise Pamela L. Caughies Virginia Woolf and Postmodernism: Literature in Quest and Question of Itself (1991), Michael Gillespies Oscar Wilde and the Poetics of Ambiguity (1996), oder Joseph Bristows »A complex multiform creature – Wilde’s sexual identities« (1997). Allerdings verweisen diese Studien ebenfalls explizit auf Autor_innen und ihre Biographien.
- 5. Oscar Wilde: »Phrases and Philosophies for the Use of the Young«. In: Collins Complete Works of Oscar Wilde. Glasgow ⁵2003 [1894], S. 1244–1245, hier S. 1244.
- 6. Virginia Woolf: »Modern Fiction«. In: Mitchell A. Leaska (Hg.): The Virginia Woolf Reader. San Diego 1984 [1925], S. 283–292, hier S. 287.
- 7. Bei nachfolgenden Zitaten aus den Romanen Mrs. Dalloway von Virginia Woolf und The Picture of Dorian Gray von Oscar Wilde werden die Seitenbelege am Ende des jeweiligen Zitats nach folgenden Ausgaben in Klammern angeführt: Oscar Wilde: The Picture and Dorian Gray and Selected Stories. New York 1983; Virginia Woolf: Mrs. Dalloway. London 1992 [1925].
- 8. Roland Barthes: Image / Music / Text. London 1986 [1977], S. 54.
- 9. Ebd., S. 145f.
- 10. Ebd., S. 52.
- 11. Jane Wheare: »Introduction«. In: Virginia Woolf: The Voyage Out. London 1992, S. ix–xxxvii, hier S. xiii.
- 12. Butler: Undoing Gender (Anm. 1), S. 43.
- 13. Michael Patrick Gillespie: Oscar Wilde and the Poetics of Ambiguity. Gainesville 1996, S. 11.
- 14. Roland Barthes: Mythologies. New York 1972, S. 9.
- 15. Butler: Undoing Gender (Anm. 1), S. 47.
- 16. Ebd., S. 15.
- 17. Ebd., S. 226.
- 18. Ebd., S. 206.
- 19. Barthes : Mythologies (Anm. 14), S. 128.
- 20. Roland Barthes: S/Z. An Essay. New York 1974, S. 11.
- 21. Michel Foucault: »What is an Author?« In: Donald F. Bouchard (Hg.): Language, Counter-Memory, Practice. New York 1977 [1970], S. 113–138, hier S. 116.
- 22. Elizabeth Abel: »Narrative Structure(s) and Female Development: The Case of Mrs. Dalloway«. In: Harold Bloom (Hg.): Virginia Woolf’s Mrs. Dalloway: Modern Critical Interpretations. New York 1988, S. 104.
- 23. Barthes: S/Z. An Essay (Anm. 20), S. 105.
- 24. Lee Edelmann: Homographesis: Essays in Gay Literature and Cultural Theory. New York 1994, S. 23.